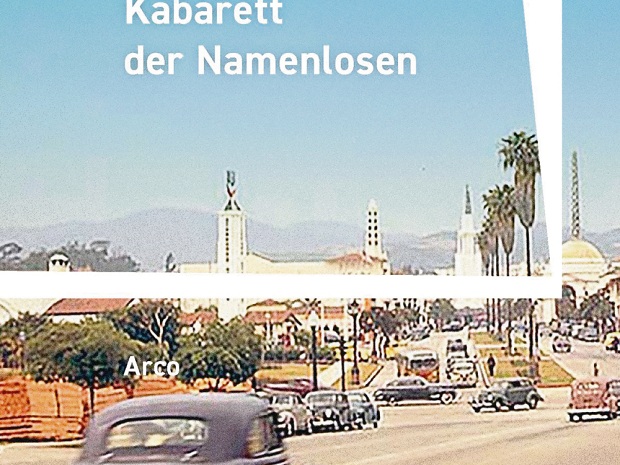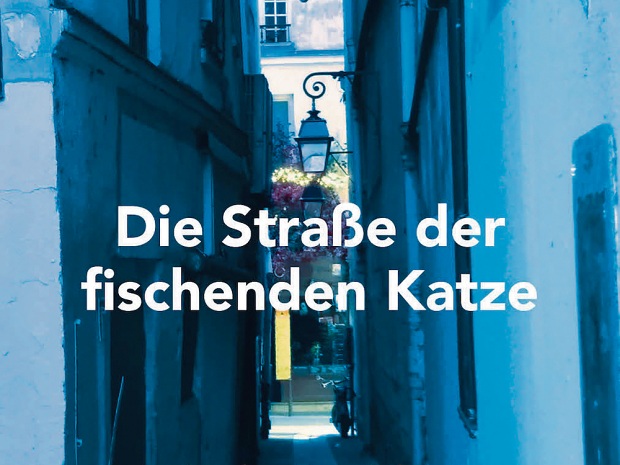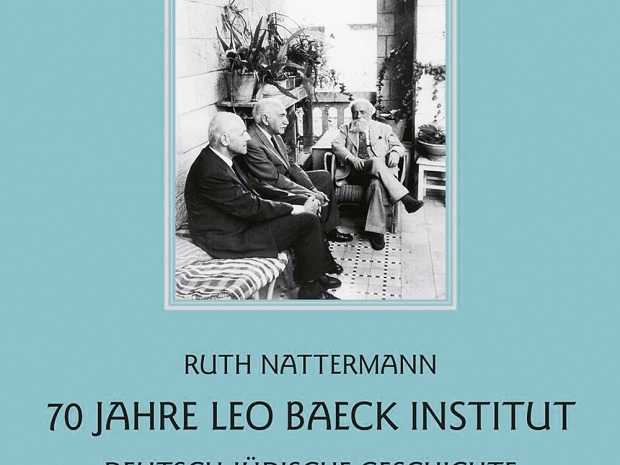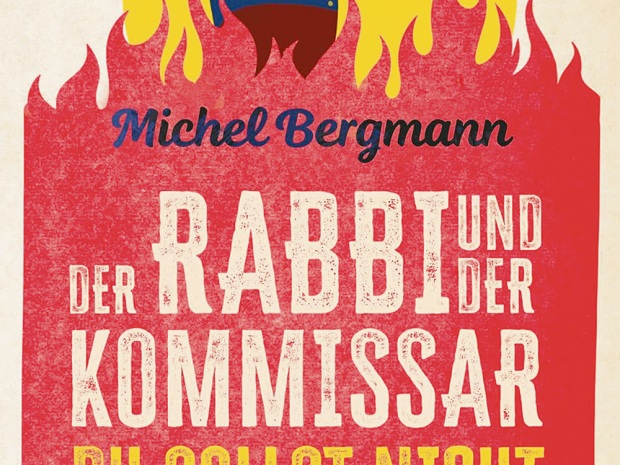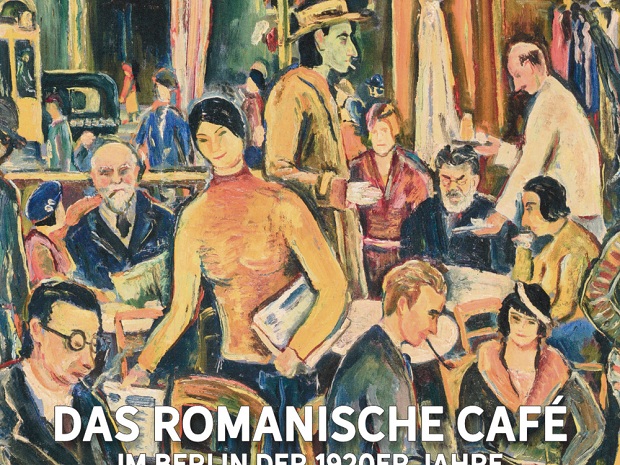Vom Misstrauen zur Freundschaft: Eldad Beck über die wechselhaften Beziehungen zwischen Österreich und Israel

Mit kaum einem westlichen Land hat Israel zwischen 1970 und Anfang 2000 so viele Krisen erlebt wie mit Österreich. Es sei an dieser Stelle an die pro-arabische Haltung des linken SPÖ-Kanzlers Bruno Kreiskys erinnert. Doch heute befinden sich die Beziehungen auf einem Allzeithoch. Österreich ist unter der Führung der bürgerlichen ÖVP viel israelfreundlicher geworden als Deutschland, sagt der israelisch-österreichische Journalist Eldad Beck im Interview. Der heute in Wien lebende Autor hat sich in einem soeben auf Hebräisch erschienenen Buch mit der Geschichte der wechselvollen Beziehungen - von Kaiser Franz Joseph I. bis in die Gegenwart - beschäftigt, das den treffenden Titel „Späte Versöhnung“ trägt. (JR)
Mit keinem westlichen Land hat Israel zwischen 1970 und Anfang 2000 so viele Krisen erlebt wie mit Österreich. Doch heute befinden sich die Beziehungen auf einem Allzeithoch. „Österreich ist viel israelfreundlicher geworden als Deutschland“, sagt der israelisch-österreichische Journalist Eldad Beck im Interview. Das sei vor allem Bundeskanzler Sebastian Kurz zu verdanken. Der heute in Wien lebende Autor hat sich in einem soeben auf Hebräisch erschienenen Buch mit der Geschichte der wechselvollen Beziehungen - von Kaiser Franz Joseph I. bis in die Gegenwart - beschäftigt, das den treffenden Titel „Späte Versöhnung“ trägt. Im Interview spricht der Autor über die Ursachen der früheren Verstimmungen, die Besonderheiten des österreichisch-jüdischen Verhältnisses, die Revolution" unter Kurz und die Veränderungen in der österreichischen Gesellschaft. Beck kritisiert den ehemaligen jüdischen und sozialdemokratischen Bundeskanzler Bruno Kreisky und die fehlende Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus der Linken.
Sie haben viele Jahre sowohl in Deutschland als auch in Österreich gelebt. Sind Ihnen Unterschiede im Verhältnis zu Israel und zum Judentum aufgefallen?
Ich bin mit einer falschen Vorstellung nach Deutschland gekommen, wo ich insgesamt 22 Jahre gelebt habe. Zuerst dachte ich, Deutschland hätte seine Vergangenheit viel besser aufgearbeitet als Österreich. Nun habe ich das Land wirklich von innen kennen gelernt, und irgendwann habe ich angefangen, mich in Österreich wohler zu fühlen, weil man hier weiß, mit wem man es zu tun hat. Die Leute verstecken ihre Meinung nicht, sondern sagen direkt, was sie denken, ob es angenehm ist oder nicht. In Deutschland spüre ich überall Heuchelei: Die Leute wiederholen die gleichen Mantras, mehr aus Pflichtgefühl als aus Überzeugung. Das merkt man besonders beim Thema Israel und Judentum.
Natürlich gibt es Deutsche, die meinen, was sie sagen. Aber das ist eine sehr kleine Gruppe, und genau mit der haben es Israelis oft zu tun, wenn sie es mit Deutschland zu tun haben. Deshalb glauben sie, dass ganz Deutschland so denkt. Doch es gibt einen großen Unterschied zwischen den politischen Eliten in Deutschland und dem Volk.
Aber Sie hatten früher auch Ihre Schwierigkeiten mit Österreich?
Ja, die hatte ich, zum Beispiel habe ich mich geärgert über die unkritischen Lobeshymnen aller Parteien auf den tödlich verunglückten Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ) im Jahr 2008. Ich finde, das hat er nach all seinen problematischen Äußerungen zum Dritten Reich nicht verdient.
Die Familie meines Vaters stammt aus Wien. Mein Großvater ging 1932 nach Israel, später wurde fast die ganze Familie ermordet. Ich habe die viel zu geringe Summe vom Nationalfonds als Entschädigung abgelehnt. Meine Ehre verbietet mir das. Ich sehe Österreich nicht mit blauen Augen, und gerade deshalb fand ich die Geschichte von Bundeskanzler Sebastian Kurz (2017 bis 2021) so bemerkenswert. Er interessiert sich für die Gegenwart und Geschichte des Judentums und Israels, obwohl er einer Generation angehört, die sich eigentlich nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen will. Er hat die österreichische Politik von Grund auf verändert. Das war eine Revolution, für Israel und für die Juden, die sich hier in den letzten Jahren endlich wohlfühlen und sich als Teil dieses Landes sehen. Hoffentlich bleibt es auch so.
Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch: Kurz hat den Juden in Österreich ein Heimatgefühl gegeben. Ist das nicht übertrieben?
Nein, und ich glaube, das gilt für fast alle Juden in Österreich und darüber hinaus. (Anmerkung: Durch eine von Kurz initiierte Gesetzesänderung erhalten Nachkommen von NS-Opfern leichter als bisher die österreichische Staatsbürgerschaft.) Juden, die schon lange hier leben, wissen sehr genau, wie sich ihre Situation durch Kurz verändert hat. Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde, auch wenn sie der SPÖ nahestehen, sprechen in meinem Buch ganz deutlich darüber.
Bisher scheint der Einfluss von Kurz auch nach seinem Abgang anzuhalten. Das zeigte sich etwa nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023. Österreich stimmte als einer von 14 Staaten gegen eine UN-Resolution, die von Israel einen sofortigen Waffenstillstand forderte. Deutschland enthielt sich der Stimme. In der Vergangenheit hat Österreich in der UNO meist das getan, was Deutschland tut.
Das hat sich mit Kurz geändert. Österreichs Israel-Politik hat sich von Deutschland gelöst. Der jetzige Bundeskanzler Karl Nehammer setzt diese Linie fort. Österreich ist viel israelfreundlicher geworden als Deutschland, das sich immer zuerst für Israel ausspricht, dann aber in der EU anders agiert.
Für Sebastian Kurz war Israel extrem wichtig, und er wollte auch, dass Israel weiß, was er denkt und tut. Persönlich und beruflich hatte ich noch nie einen so direkten Zugang zu einem europäischen Politiker. Während des Nationalratswahlkampfes 2017 habe ich versucht, ein Interview mit ihm zu bekommen. Man sagte mir, er sei zu beschäftigt, aber wenn er die Wahl gewinnt, bekäme ich sofort ein Interview. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, aber noch in der Wahlnacht hat sich einer seiner Berater deshalb bei mir gemeldet. So habe ich nach der Wahl das erste Interview mit Kurz für ein israelisches Medium geführt, ein noch ausführlicheres zwei Monate später, als er Bundeskanzler wurde, und ein weiteres nach dem Terroranschlag in Wien am 2. November 2020.
Warum fühlt sich jemand, der weder aus einer Nazi-Familie stammt noch jüdische Wurzeln hat, Israel und den Juden so verbunden? Seine Antwort war: „Ich stelle mich gegen Unrecht, und in beiden Fällen – Israel und Judentum – sehe ich, wie oft Unrecht geschieht. Das hat mich dazu bewogen“.
War Kurz‘ Israel-Politik der Auslöser für Ihr Buch?
Ursprünglich wollte ich nur ein Buch über Kurz und seinen Beitrag zur Verbesserung der österreichisch-israelischen Beziehungen schreiben. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich auch über das jahrzehntelang sehr problematische Verhältnis zwischen Österreich, den Juden und Israel schreiben muss, weil man sonst Kurz‘ Beitrag nicht versteht. Es gibt wohl kein westliches Land, mit dem Israel seit den 1970er Jahren so viele Krisen erlebt hat, zuerst mit Bundeskanzler Bruno Kreisky (1970 bis 1983), dann mit Bundespräsident Kurt Waldheim (1986 bis 1992) und schließlich im Jahr 1999 mit der Regierungsbeteiligung von Jörg Haiders FPÖ.
Sie liefern in Ihrem Buch eine originelle Erklärung für diese Krisen.
Auch wenn das Buch „Späte Versöhnung“ heißt, glaube ich, dass die Probleme damit zu tun haben, dass sich Israel nach 1948 sehr schnell mit Österreich versöhnt hat. Aber es war von beiden Seiten eine künstliche, opportunistische Versöhnung, zunächst aus wirtschaftlichen Gründen: Israel brauchte wirklich jede Unterstützung, um zu überleben, vor allem wegen des arabischen Boykotts, und auch Österreich war in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Das erste Abkommen zwischen den beiden Staaten war daher ein wirtschaftliches.
Außerdem kamen ab den 1950er Jahren immer mehr Juden aus dem Ostblock über Österreich nach Israel. Österreich fungierte als Brücke dieser für Israel existenziellen Einwanderung. Israel verschloss daher die Augen vor Österreichs Geschichte, verzichtete auf entsprechende Entschädigungszahlungen und ersparte Österreich die Auseinandersetzung mit seiner Rolle während des Dritten Reiches. Österreich konnte sich weiterhin als Opfer Hitlers sehen und wehrte sich erfolgreich gegen umfassende Reparationen.
Hatten die Schwierigkeiten auch mit der sehr spezifischen jüdischen Geschichte in Österreich zu tun? Gerade in Wien gab es ein blühendes jüdisches Leben, das nach dem „Anschluss“ unter aktiver Beteiligung unzähliger Wiener rasch zerstört wurde.
Vor dem Holocaust war die Geschichte der Juden in Österreich besonders erfolgreich – mehr noch als in Deutschland. Vom späten 19. Jahrhundert bis zum „Anschluss“ hatten Juden hier großen Einfluss, ihre Namen wurden weltweit bekannt. Aber Erfolg erzeugt Hass und Neid. Manche sahen in der Judenverfolgung eine Chance, sich der unliebsamen Konkurrenz zu entledigen.
Den Österreichern haftet das Image an, die besseren Nazis gewesen zu sein. Prominente Nazis wie Adolf Hitler, Alois Brunner und Amon Göth waren Österreicher, und Adolf Eichmann wuchs in Österreich auf. Wenn man jedoch die Hierarchie der NSDAP und SS genau studiert, kommt man zum Schluss, dass die Österreicher nicht unbedingt übermäßig präsent waren.
In vielen Geschichtsbüchern wird der Ausbruch der Gewalt gegen die Juden nach dem „Anschluss“ beschrieben. Das ging viel schneller als in Deutschland, wo Juden ab 1933 noch Zeit hatten, Deutschland zu verlassen. Sie erlebten nicht die Schrecken der österreichischen Juden und behielten zum Teil idealisierte Bilder vom früheren Deutschland in Erinnerung.
Unter Bruno Kreisky kam es recht rasch zur ersten Krise zwischen Israel und Österreich.
Im Oktober 1973, eine Woche vor dem Jom-Kippur-Krieg, fanden in Jerusalem zwei Regierungssitzungen statt, die sich ausschließlich mit Österreich befassten. Im September hatten „palästinensische“ Terroristen an der Grenze zur Tschechoslowakei drei jüdische Emigranten aus der Sowjetunion und einen österreichischen Polizisten als Geiseln genommen. Kreisky erfüllte ihre Forderungen und schloss das Transitlager für jüdische Emigranten im Schloss Schönau. Israel war entsetzt. Golda Meir reiste sogar nach Wien, um mit Bruno Kreisky zu sprechen.
Österreich fand sofort Ersatz für das Transitzentrum. Der Zustrom von Juden nach Israel nahm sogar zu.
Es war eigentlich viel Lärm um nichts. Die Israelis haben unglaublich hysterisch reagiert und hätten auf Kreisky hören sollen, der gesagt hat, dass der Transit durch Österreich nicht aufhören wird. Aber er hatte seine Probleme mit Israel und mit den dortigen Sozialisten, und sie hatten ihre Probleme mit Kreisky. Israel konnte ihm nicht trauen. Man wusste, dass er kein Freund war. Schon in den 1950er Jahren hatte er einem israelischen Vertreter gesagt: Österreich braucht keine Beziehungen zu Israel.
Wie einflussreich war Kreiskys pro-arabische Haltung?
Unter Berufung auf die österreichische Neutralität verfolgte er eine dezidiert pro-arabische Politik. Noch als Außenminister besuchte er 1964 den ägyptischen Präsidenten Abdel Nasser in Kairo. In Wirklichkeit betrieb er keine Neutralitätspolitik, sondern signalisierte der PLO und den Arabern: Ich stehe auf eurer Seite. Kreisky machte Arafat im Westen salonfähig. Die Zwei-Staaten-Idee ist gewissermaßen seine Erfindung. Vorher gab es in Westeuropa, auch in Österreich, keine Unterstützung für einen „palästinensischen“ Staat. Kreisky war der erste, der die Sozialistische Internationale und auch einige Linke in Israel von dieser Idee überzeugte – bis 1993 tatsächlich das Oslo-Abkommen unterzeichnet wurde. Kreisky lebte nicht mehr, aber er war der Vater dieses Prozesses.
Warum engagierten sich israelische Politiker wie Shimon Peres, die Kreisky nicht ausstehen konnten, Jahre später für den Oslo-Prozess?
Peres und Kreisky hassten sich und sagten sich schreckliche Dinge. Aber 1993 verkündete Peres genau jene Zweistaatenlösung, die Kreisky zuvor gefordert hatte. Das ist wirklich unglaublich. Die Linken in Israel haben Anfang der 1990er Jahre, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende der Apartheid in Südafrika, geglaubt, die Welt habe sich verändert. Ich würde von fast messianischen Erwartungen an eine neue Ära sprechen...
... die sich im Rückblick nicht erfüllt haben?
Als jemand, der das Oslo-Abkommen damals zunächst unterstützt hat, sage ich heute: Vielleicht hätte man es anders machen können. Aber die Art und Weise der Durchführung führte in eine Katastrophe, beginnend mit der Terrorwelle schon vor der zweiten Intifada. Die israelischen Befürworter von Oslo haben diesen Prozess mit fast religiöser Inbrunst unterstützt und als alternativlos dargestellt. Peres nannte ihn unumkehrbar – was eigentlich Unsinn war. Aber er glaubte daran und verschloss die Augen vor der Realität.
Verdrängte auch Kreisky die Realität?
Dass Arafat ein Lügner war, erlebte Kreisky schon 1979, als er den PLO-Chef nach Wien einlud. Politiker aus Frankreich und den USA sagten aber im letzten Moment ab, weil Arafat sich nicht auf Bedingungen wie die Anerkennung Israels, das Ende von Terrorismus und die Akzeptanz einer Reihe von Resolutionen einlassen wollte. Immer wieder hat Arafat erst viel versprochen und dann etwas anderes gesagt. Dieses Doppelspiel war keine Erfindung der 1990er Jahre. Was er wirklich über Israel dachte, sagte er nur auf Arabisch. Auch nach dem Oslo-Abkommen hat er sich überhaupt nicht geändert. Seine Vision war von Anfang an die etappenweise Vernichtung Israels. Das ist der Plan der PLO von 1974, das ist der Plan der PLO von heute. Oslo war die Fortsetzung davon.
Es gab Höhen und Tiefen in der Beziehung zwischen Kreisky und Arafat. Kreisky war nicht immer mit dem einverstanden, was Arafat sagte, und oft genug von ihm enttäuscht. Aber anstatt sich einzugestehen, dass Arafat kein Partner sein kann, machte er denselben Fehler wie viele israelische Linke. Er dachte: Arafat muss sich noch entwickeln, wir werden ihm zeigen wie.
Die nächste Krise folgte, als Kurt Waldheim, der sich schon als UN-Generalsekretär in Israel unbeliebt gemacht hatte, Bundespräsident wurde. Im Wahlkampf wurde seine NS-Vergangenheit zum Thema. Kritik kam vor allem vom Jüdischen Weltkongress (WJC) – aber nicht im gleichen Maße aus Israel.
Israel war sehr vorsichtig, weil es immer noch Interessen in Österreich als Brücke zum Ostblock hatte. Auch die israelischen Medien waren gespalten. Manche meinten, Israel sollte sich zurückhalten.
Wie beurteilen Sie rückblickend das Verhalten des WJC?
Es war wichtig, diesen Kampf zu führen, damit Österreich endlich seine Geschichte aufarbeitet. Die Reden von Bundeskanzler Franz Vranitzky (1986 bis 1997) – zuerst 1991 im österreichischen Nationalrat, dann 1993 an der Hebräischen Universität in Jerusalem –, in denen er sich erstmals offen zur Mitschuld von Österreichern an den Verbrechen der Nationalsozialisten bekannte, wären ohne die Waldheim-Affäre nicht möglich gewesen.
Spätere Reden von Sebastian Kurz – etwa in Jerusalem oder in Brüssel vor dem American Jewish Committee – waren noch mutiger. Aber damals hat ein Prozess begonnen – neuerlich mit Rückschlägen, vor allem unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (2000 bis 2007), den ich viel kritischer sehe, auch durch die Art und Weise, wie er in einem Interview die Idee von Österreich als erstem Opfer der Nazis wiederbelebt hat. Das „Washingtoner Abkommen“ zwischen Österreich und den USA zur Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus im Jahr 2001 war aus meiner Sicht eine verpasste Chance, endlich Frieden zwischen Österreich und den enteigneten Juden zu schaffen – auch wenn heute alle sagen, es sei das beste Abkommen gewesen. Generell bleibt ein bitterer Nachgeschmack, vor allem bei vielen Juden der ersten und zweiten Generation.
Wegen der Waldheim-Affäre begann in Österreich eine intensive Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Lehrer, Bürgermeister, Wissenschaftler initiierten unzählige Projekte, bei denen Schüler Holocaust-Überlebende trafen. Erfolgte die späte Aufarbeitung in Österreich eher von unten als von oben?
Ja, und vielleicht hat sie gerade deshalb zum Teil viel besser funktioniert. Sie geschah nicht unter Zwang und weil man sie machen musste, wie es in Deutschland oft der Fall war, sondern weil die Leute sie machen wollten und verstanden haben, wie wichtig sie ist. Deshalb glaube ich auch, dass die Krisen, die Israel mit Österreich hatte, letztlich gut für diese Beziehung waren, weil sie zu einer Veränderung geführt haben, die aber aus der österreichischen Gesellschaft heraus kam.
Diese Entwicklung hat auch die FPÖ erfasst. Im Gegensatz zu Jörg Haider hat sich der spätere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache intensiv mit der Vergangenheit auseinandergesetzt und auch Dinge gesagt, die nicht unbedingt von allen in seiner Partei geteilt wurden. Während der ÖVP-FPÖ-Regierung unter Kurz (2017-2019) gab es von verschiedenen Seiten Bestrebungen, das Verhältnis der FPÖ zu Israel zu normalisieren. Ob es dazu gekommen wäre, wenn die Regierung länger gedauert hätte und nicht durch die Ibiza-Affäre beendet worden wäre, ist Spekulation. Immerhin haben viele FPÖ-Mitglieder und -Wähler heute eine pro-israelische Haltung. Es gibt viel mehr Verständnis für Israel.
Eldad Beck wurde 1965 in Haifa geboren. Nach dem Studium der Arabistik und des Islam an der Sorbonne arbeitete er zunächst in Paris als Nahost-Korrespondent für verschiedene israelische Medien, darunter das IDF-Radio, die Zeitung „Hadashot“, die Jerusalem Post und den israelischen Fernsehsender Channel 2. Als einer der wenigen israelischen Journalisten berichtete er auch aus zahlreichen arabischen und muslimischen Ländern. Seine Erfahrungen dort schilderte er 2009 in dem Buch „Jenseits der Grenze".
Von 2002 bis 2016 war Beck Deutschland- und Mitteleuropakorrespondent von „Yedioth Ahronot“, von 2017 bis 2023 Europakorrespondent von „Israel Hayom“. Seit 2024 schreibt er für die Jerusalem Post und Mida über Europa. Beck hat in den vergangenen zehn Jahren drei Bücher über Deutschland geschrieben: „Germany at Odds“, „Die Kanzlerin – Merkel, Israel und die Juden“ und „Alternative – Neue Rechte für Deutschland“.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung