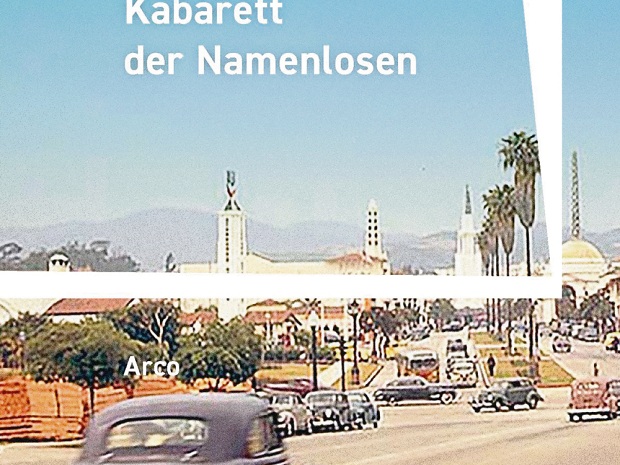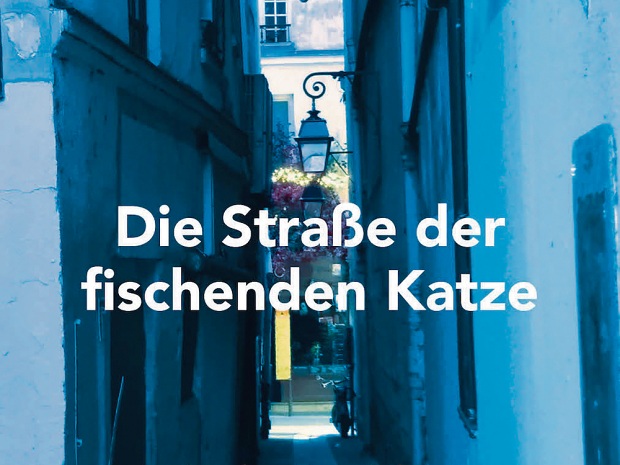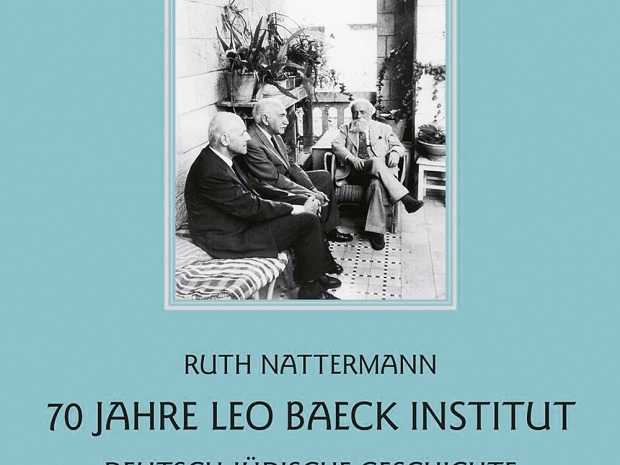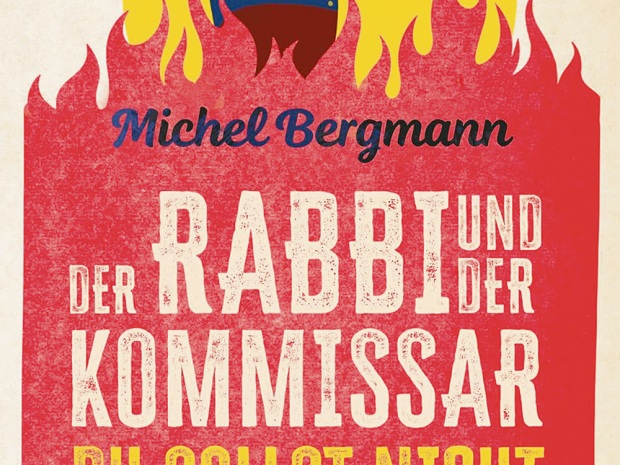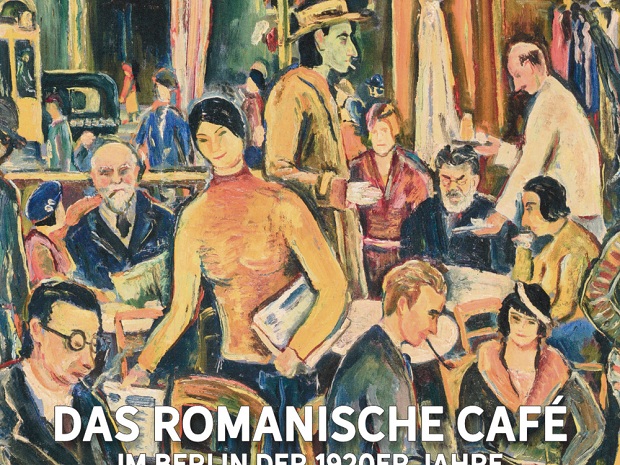Leonard Cohen – Zwischen Musik und Spiritualität

Leonard Cohen schrieb mit seinen Songs unvergessliche Musikgeschichte. © PAUL BUTTERFIELD GETTY IMAGES NORTH AMERICA Getty Images via AFP
Der geniale jüdisch-kanadische Musiker und Songwriter Leonard Cohen hinterließ mit seinem Tod im November 2016 ein monumentales musikalisches Vermächtnis. Seine Lieder waren voller religiöser Bezüge und gaben stets seine eigene philosophisch-spirituelle Suche wieder. Cohens in seiner Jugend intensiv gelebte jüdische Herkunft und sein Glaube prägten auch in späterer Zeit seine Perspektive auf das Leben, die Liebe und die Musik. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen „So Long, Marianne“ oder „Everybody knows“. Mit seinen Stücken wie „Hallelujah“ – eines der meist gecoverten Songs überhaupt - oder „First We Take Manhattan“, schrieb er Musikgeschichte. Seine Hingabe lebt in seinen Liedern weiter, die wie Gebete sind – zeitlos, tröstend und von universaler Magie. (JR)
Als der Tod des am 7. November 2016 in Los Angeles gestorbenen kanadischen Singer-Songwriters Leonard Cohen bekannt gegeben war, wurden ihm zu Ehren die Staatsflaggen in Montreal, seiner Geburtsstadt, auf halbmast gesetzt.
Leonard Cohen war viel mehr als ein Singer-Songwriter – er war Romancier und Maler. Ja, auch ansehnlicher Maler, der einige seine Werke illustriert hat. Er verfügte auch über eine ausgeprägte und vielseitige Begabung als Zeichner. Er war, so charakterisiert ihn sein Sohn Adam Cohen, bei allen künstlerischen und das Leben betreffenden Strategien, die er in seinem über 80 Jahre währenden reichen und komplizierten Leben angewendet hat, unbeirrt seinen Weg als ambitionierter Schriftsteller gegangen. Kurz: Für Leonard Cohen war Schreiben sein einziger Trost, sein wahrhafter Lebenszweck.
Cohen verkörperte Jüdischkeit durch und durch
Nie versiegendes Schreiben war das Feuer, das er entzündete, das er hegte, war die Flamme, die er schürte. Das Aufregende in einem in Flammen stehenden Gedanken war es, das ihn lebenslang antrieb. All das Gesagte spiegelt sich in seinem posthum erschienenen Buch „Die Flamme“ mit seinen eigenen Illustrationen wider - eine liebevolle, fast zärtliche Hommage an einen großartigen Künstler. In diesem Buch präsentiert eine Auswahl von Einträgen aus Cohens Notizbüchern, die er seit seiner Teenagerzeit bis zum letzten Tag seines Lebens täglich geführt hat. Seine Texte sind persönlich-intim, tiefgründig und geprägte von einer Jüdischkeit, die sein Leben und Werk bestimmt haben. „Ich schaue, Hand am Herzen/Unsere Flagge an/Hoffentlich gewinnen sie/Die Kriege, die wir so gerne starten“.
Das ewige Ringen jüdischer Theologie, nach der Shoah trotzdem noch an HaSchem zu glauben, wird durch Wut und Vorwürfe aufgelöst. Cohen besingt hier den Heil verheißenden und zugleich Heilung verweigernden jüdischen Gott. Auf dem Frankfurter Flughafen vermerkte er am 19. Februar 2001 in sein Notizbuch 15-40: „Ich möchte beten/fünf Mal am Tag/und das tue ich/Ich möchte leben/ als lebte G-tt/durch mich an dich/und das tue ich“.
Von allen Künstlern im Bereich der populären Musik, war niemand „jüdischer“ als Leonard Cohen. Cohen verkörperte Jüdischkeit durch und durch, angefangen von seinem Namen endend mit seinem letzten Song, der drei Wochen vor seinem Tod erschien: „You want it darker“. Das war sein Abschied von dieser Welt, sein persönliches „Kaddisch“.
Eine lebenslange Suche
Der 1934 in Montreal geborene Leonard Cohen wuchs in einem ausgesprochen jüdischen Milieu auf, bewegte sich zeitlebens auf jüdischen Wegen - als Mensch und als Künstler. Seit den Sechzigerjahren stand er gleichberechtigt neben den beiden anderen großen jüdischen Songwritern des Jahrhunderts - Bob Dylan und Paul Simon. Musikalisch wurde er selten im gleichen Atemzug genannt, als Persönlichkeit aber überstrahlte er beide. Seine Songs changieren zwischen amourös und religiös.
Mit seinem Namen „Cohen“ war er als eindeutig „jüdisch“ markiert, doch kam für ihn - trotz aller Nachteile, die ihm als Jude entgegenschlugen - nie ein Namenswechsel in Betracht. In einem TV-Interview sprach ihn ein Reporter auf eine Namensänderung einmal an und Cohen ließ mit seiner Antwort Raum für Spekulationen, indem er sagte, er gedächte, den Namen „September“ anzunehmen. Der verblüffte Interviewer war völlig irritiert und meinte: „Leonard September“? Nein, war die Antwort, „September Cohen“. Ein für einen Nichtjuden schwer zu verstehender ironischer Witz, den Cohen damit zum Besten gab, eine witzige Bemerkung mit tiefsinniger jüdischer Konnotation dazu.
Mit „September“ meinte Cohen den hebräischen Monatsnamen „Elul“, auch genannt der „Monat der Gnade und des Vergebens“, die Zeit der Buße als Vorbereitung auf die Hohen Feiertage Rosch ha-Schana und Jom Kippur. Elul ist der zwölfte und letzte Monat des bürgerlichen jüdischen Kalenders und der sechste des religiösen jüdischen Kalenders nach der Zählung im jüdischen Kalender. Er hat 29 Tage und fällt im gregorianischen Kalender in die Zeit von August und September. Elul bedeutet übersetzt so viel wie Suche, der Mensch soll sich in dieser Zeit auf die bevorstehenden Tage des Gerichts und der Versöhnung einstellen. All dies traf auf den „suchenden“ Cohen zu und war der Weg, den er zeitlebens einzuschlagen suchte.
Als Musiker schuf Leonard Cohen melancholisch gefärbte, poetische Lieder, die von zahlreichen Künstlern übernommen wurden. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen „So Long, Marianne“; „Everybody knows“. Mit seinen Stücken wie „Hallelujah“ – eines der meist gecoverten Songs überhaupt - oder „First We Take Manhattan“, schrieb er Musikgeschichte.
Leonard Cohen war, wie Bob Dylan, ein Mann der vielen Gesichter und er, der Poet, wäre gewiss ein ebenso würdiger, wenn nicht der geeignetere Literatur-Nobel-Preis-Träger gewesen.
Songs wie Gebete
Gleich sein erster Song war ein Welterfolg aus dem Jahre 1967/68, ein Lied, das eine ganze Generation ins Herz traf, das berührte – Suzanne. Leonard Cohen schrieb seine Songs, wie er einmal bemerkte, weil er nicht anders konnte, „um die Frauen rumzukriegen“. Erst später schrieb er Songs, um Geld zu verdienen.
Bob Dylan sagte einmal zu Leonard Cohen, er habe das Gefühl, dass sich seine Songs allmählich „zu Gebeten entwickelten“. Damit hatte Dylan recht. Auf keinen Song traf das mehr zu als auf „If It Be Your Will“. Es war „ein altes Gebet“, meinte Leonard Cohen, „das über mich kam, damit ich es umschrieb“. Ein berührender Song, intim und zerbrechlich: „Ist es dein Wunsch, dass eine Stimme wahr spreche,/Singe ich zu dir von diesen Hügeln./Von diesen Hügeln/Aller Lobpreis erklinge/Wenn du wünschst, dass ich singe.“ Hat man je in der populären Musik einen solchen Text gehört?
„Dance Me to the End of Love“ ist sein Song aus dem Jahr 1984. Er findet sich auf Cohens 1984 erschienenen Album „Various Positions“ und wurde von verschiedenen Künstlern adaptiert. Die Instrumentals von „Dance Me to the End of Love“ erinnern an traditionelle Klezmermusik. Auf seine Musik angesprochen, die „jüdisch“ klinge, antwortete Cohen 1985 in einem Interview: „Meine Lieder sind immer jüdisch, sie können nichts anderes als jüdisch sein.“ Und auf die Frage, was es heiße, Jude zu sein, antwortete er: „Es ist, als würde man sagen, dass jemand ein bisschen schwanger oder ein bisschen tot ist. Ich schreibe aus meiner eigenen Tradition. Mein Herz wurde in der jüdischen Tradition geformt“. Obwohl als Liebeslied strukturiert, wurde „Dance Me to the End Of Love“ tatsächlich vom Holocaust inspiriert. In einem Radiointerview von 1995 sagte Cohen über das Lied: „Es ist merkwürdig, wie der Song beginnt, weil der Ursprung des Liedes, jedes Lied, eine Art Korn oder Samen hat, die jemand dir oder die Welt reicht. Aber das rührt vom Hören oder Lesen oder Wissen her, dass in den Todeslagern neben den Krematorien ein Streichquartett aufspielte, während der Horror vor sich ging. Das waren Menschen, deren Schicksal auch dieser Horror war. Und sie spielten klassische Musik, während ihre Mitgefangenen getötet und verbrannt wurden. Also, diese Musik, ‚Tanze mich zu deiner Schönheit mit einer brennenden Geige‘, bedeutet, dass die Schönheit die Vollendung des Lebens ist. Es ist die gleiche Sprache, die wir verwenden, um uns dem Geliebten zu ergeben“.
Legendäres Konzert in Berlin
Immer wieder gastierte Cohen in Berlin. Ein Konzert in Berlin ist nachdrücklich in Erinnerung geblieben: Cohens Deutschlandtournee, die er am 8. April 1973 im Berliner Sportpalast, im Berliner Ortsteil Schöneberg gelegen, beendete, wurde in der Presse so beschrieben: „Da steht er, fast unbeweglich auf einem Fleck, mit seiner Gitarre auf der Bühne, erst ziemlich unbeholfen, später freier in den Bewegungen, singt viel und spricht wenig.“ Im Hinblick auf Cohens Musik waren die Kritiker nicht zufrieden. „Bleiben also die Cohenschen Texte“, resümierte die „Berliner Zeitung“, schöne, „poetische, deftige, skeptische, aber auch skurrile und nicht immer verständliche Wortgebilde“, wobei bei den Zuschauern mangelnde Detailkenntnis der englischen Sprache vielleicht auch eine Rolle gespielt hatte.
Cohens Gitarrist hatte sich bei seinem vorherigen Konzert in London eine Grippe „eingefangen“ und konnte in Berlin nicht spielen. Ein Berliner Gitarrenspieler hatte davon gehört und eilte in Cohens Berliner Hotel und bot sich als Ersatz an. Cohen war nicht abgeneigt, ließ sich einige Riffs vorspielen und war mit dem Gitarrenspiel zufrieden. Die beiden rauchten anschließend einen Joint und los ging es auf die Bühne. Das Berliner Publikum war unruhig und unkonzentriert, was Cohen missfiel. Er ließ den Saal weiter abdunkeln, einen Spot auf sich richten und provozierte mit einem Satz – auf Deutsch! - den fatalen Goebbels-Ausspruch zitierend, den jeder Deutsche irgendwann schon einmal gehört hatte: „Wollt ihr den totalen Krieg?“, ein Satz aus dem Mund des hinkenden Propagandaministers, drei Jahrzehnten zuvor an gleicher Stelle vor einem aufgepeitschten, enthusiasmierten Publikum gefallen.
Die Worte gingen in der allgemeinen Cohen-Begeisterung unter, irritierten jedoch auch. Jubel und Empörung im Sportpalast hielten sich die Waage. „Ich war ärgerlich. Das Publikum brauchte einen Führer, es war undiszipliniert. Da dachte ich an Goebbels Rede in diesem Haus anno 1943“, bemerkte Cohen dazu in einem Interview des Magazins POP (1972). Der Reporter der „Berliner Morgenpost“ versuchte die Konzertatmosphäre einzufangen: „Auf Einwürfe aus dem Publikum hat er eigentlich immer eine Entgegnung parat. Selbst wenn es ein Hund ist, der während eines leisen Liedes bellt. Leonard Cohen kann dies nicht aus seiner Ruhe (seiner Geborgenheit in seinen Songs, möchte man meinen) bringen“.
Cohen kam immer wieder zu Konzerten nach Berlin. Am 23. April 1976 in der Berliner Philharmonie hieß es in der Berliner Presse: „Der ruppig-eintönige, wenn auch immer stimmige Singsang der frühen Jahre löst sich auf in befreiende, mitunter auch fetzende Musikalität. [. . .] Und plötzlich, ohne Vorwarnung, singt er deutsch: ‚Die Gedanken sind frei‘, von Cohen empfunden, auf der Gitarre begleitet. Damit überraschte Cohen erneut mit einer bis dato noch nie gehörten Coverversion.“
Im Juli 2013 gab der kanadische Ausnahmekünstler sein letztes Konzert in Berlin.
„Hallelujah“
Mit einem Livealbum hatte sich Cohen 1972 vorläufig vom Musikgeschäft verabschiedet und erklärt, sich nun wieder verstärkt der Literatur widmen zu wollen. 1973 reiste er nach Ausbruch des Jom-Kippur-Kriegs von seiner Wahlheimat, der griechischen Insel Hydra, nach Israel, um das bedrohte Israel zu unterstützen. Er tourte durch die von Israel besetzte Sinai-Halbinsel, wo er vor Einheiten der israelischen Armee auftrat. In dieser Zeit entstand der Song „Lover, Lover, Lover“, ein Top-Ten-Hit (1974). Seine Alben waren in Deutschland immer sehr erfolgreich. Weltweit verkauften sie sich über sechs Millionen Mal.
Jeder kennt das eine Lied von Leonard Cohen und niemand kann sich seiner Faszination entziehen. Cohen hat geschlagene drei Jahre an diesem Lied gearbeitet, für das er am Ende insgesamt 80 Verse schrieb und diese immer wieder änderte. Die Zeilen füllten zwei Notizbücher. Schließlich gab er seinem Lied den Titel: „Hallelujah“.
„Hallelujah“ ist voller religiöser Bezüge – alttestamentarischer, biblischer. Es ist bis in die Gegenwart einer der am häufigsten aufgenommenen Songs in der Geschichte der Pop-Musik. Paradenummer für stimmstarke Kandidaten in Casting-Shows. Eine Musik, die sowohl bei Hochzeiten als auch bei Beerdigungen gespielt wird. Universale Magie in C-Dur.
Leonard Cohen äußerte sich bezüglich der zahlreichen Interpretationen in einem Interview im Jahr 2009: „Es ist ein guter Song, aber er wird von zu vielen Leuten gesungen.“ Allerdings mache sich ein leichtes Gefühl von Genugtuung in seinem Herzen breit, wenn er sich daran erinnere, dass seine amerikanische Plattenfirma den Song nicht veröffentlichen wollte: „Sie dachten, er sei nicht gut genug.“
Cohen erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter neun „Juno Awards“, den „Order of Canada“, den „Prinz-von-Asturien-Preis“ in der Sparte Literatur und 2015 den Preis der deutschen Schallplattenkritik im Bereich Pop, Rock und Jazz für sein Lebenswerk. 2018 wurde Leonard Cohen postum ein Grammy verliehen.
2010, bei seinem vorletzten Konzert in Berlin, verabschiedete er sich anrührend von seinem Publikum: Mit einem zerknitterten Hut vor der Brust und Tränen in den Augen dankte Leonard Cohen schließlich seiner großartigen Band und den Berliner Fans. Danach verließ der alte Herr zum letzten Mal hüpfend die Hauptstadt-Bühne. Vom „Abtritt einer lebenden Pop-Legende“, wusste auch die Deutsche Presseagentur diesen letzten Auftritt Cohens in ,,Old Berlin“ zu berichten. Er hatte zuvor Manhattan eingenommen – danach Berlin.
Am 21. September 2024 hätte Leonard Cohen seinen 90. Geburtstag gefeiert, am 7. November 2024 ist sein 8. Todestag.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung