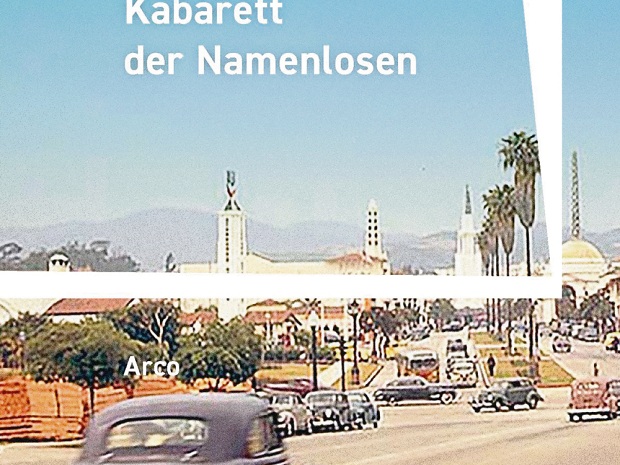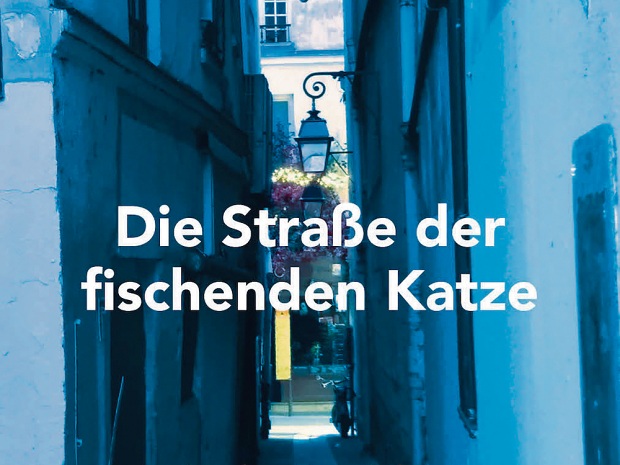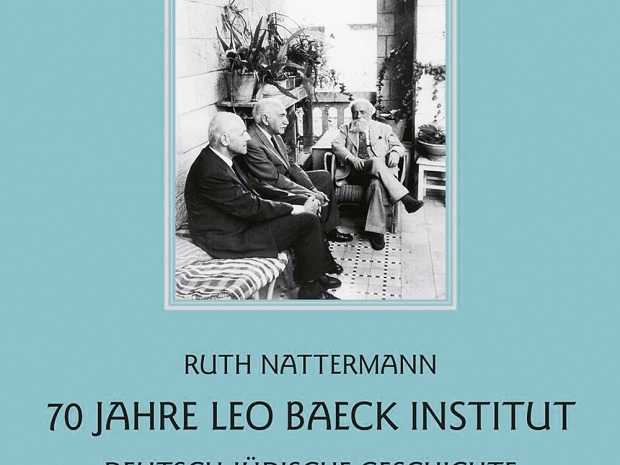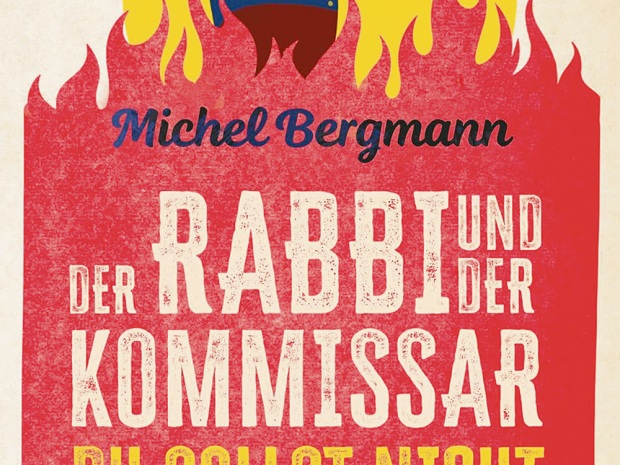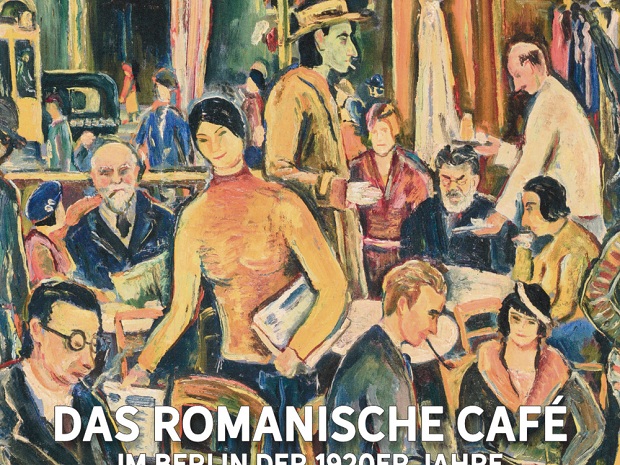Die jüdische Geschichte Wiens: Von Wohlstand und Verfolgung

Der Heldenplatz vor der Hofburg, wo Adolf Hitler am 15. März 1938 auf dem Balkon stand und zwei Tage nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich eine Rede hielt, die die Verfolgung der Juden einleitete © EMMANUELE CONTINI NurPhoto NurPhoto via AFP
Dreimal wurden Juden durch Wellen des Juden-Hasses aus der österreichischen Hauptstadt vertrieben. Doch in einer Atmosphäre, in der sie weniger angefeindet wurden, haben sie einen großen Beitrag zur Prosperität der Stadt geleistet und unauslöschliche kulturelle Spuren hinterlassen. Die größte Katastrophe, die den 170.000 jüdischen Männern, Frauen und Kindern in Wien widerfuhr, ereignete sich unmittelbar nach dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland im März 1938, weil Wien als erste Stadt im Deutschen Reich „judenfrei“ werden sollte. (JR)
Eine aktuelle Erkundung Wiens beleuchtet die prachtvolle Hauptstadt Österreichs, die an der Donau in Mitteleuropa liegt und historisch gesehen eine der bedeutendsten jüdischen Städte des Kontinents ist.
Wien hat auch eine bemerkenswerte Geschichte des Antisemitismus. Die jüdische Gemeinde wurde dreimal vertrieben: mit der ersten Wiener Gesera, die Herzog Albert V. 1420-21 erließ; mit der zweiten unter Kaiser Leopold I. 1669-70; und mit der tragischen Deportation von 65.000 Juden in Konzentrationslager während des „Anschlusses“ von 1938 bis 1945, wo sie ein grausames Schicksal erlitten.
In der Zeit zwischen diesen Verfolgungen blühte das hebräische Leben in der Stadt jedoch auf und zeichnete sich durch bemerkenswerte intellektuelle, wissenschaftliche, künstlerische, kulturelle und religiöse Beiträge aus, die nur wenige andere Städte vorweisen können. Viele der berühmtesten Einwohner der Stadt, die nach dem Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud als Stadt der Träume bezeichnet wurde, waren jüdischer Abstammung.
Die reiche Geschichte des jüdischen Lebens in Wien, die mehr als 800 Jahre zurückreicht, ist überall in der Stadt spürbar, so dass es ratsam ist, sich mehrere Tage Zeit für die Erkundung zu nehmen. Ein alternativer Reiseplan könnte ein Konzert von Mozart und Strauss beinhalten, gefolgt von einem gemütlichen Spaziergang durch den Park von Schloss Schönbrunn, der ehemaligen Residenz der Habsburger-Kaiser.
Bevor man sich auf eine Tour durch das jüdische Wien begibt, empfiehlt sich die Lektüre von „Jüdisches Wien“ aus der Reihe Mandelbaum City Guide. Mit dem Wissen über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten ausgestattet, kann man Wiens effizientes öffentliches Verkehrssystem nutzen, um eine der wichtigsten Städte der jüdischen Geschichte zu entdecken.
Im Folgenden finden Sie einige Höhepunkte meiner Reise nach Wien mit meiner Frau Ende August. Unser Flug von Tel Aviv wurde von El Al, der nationalen israelischen Fluggesellschaft, ermöglicht, die während des andauernden Konflikts zwischen Israel und der Hamas regelmäßige Abflüge vom Ben-Gurion-Flughafen aufrechterhalten hat, im Gegensatz zu einigen ausländischen Fluggesellschaften, einschließlich Austrian Airlines, die ihre Flüge zeitweise eingestellt haben.
Judenplatz
Adresse: Judenpl. 8
Nächstgelegene U-Bahn-Stationen: Herrengase (U3) oder Schottenring (U4)
Die Geschichte des jüdischen Lebens in Wien lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen, insbesondere in der Nähe des Judenplatzes. An diesem Platz ereignete sich auch die erste von drei bedeutenden Tragödien, die die jüdische Gemeinde der Stadt heimsuchten.
Die frühesten offiziellen Aufzeichnungen über Juden in Österreich stammen aus dem Jahr 904. Doch erst 1194 wird ein Jude in Wien ausdrücklich erwähnt: ein Mann namens Schlom (Schalom) wird als Münzmeister unter Herzog Leopold V. anerkannt.
Schloms Schicksal spiegelt das Schicksal unzähliger Juden in ganz Europa und Jerusalem während der Kreuzzüge wider. Als die europäischen Christen ins Heilige Land vordrangen, verübten sie Gewalt gegen Juden, darunter das Massaker an Schlom und 15 Mitgliedern seines Haushalts in Wien im Jahr 1196.
Die Geschichte von Schlom und anderen Wiener Juden wird im Jüdischen Museum Wien präsentiert, das über einen zweiten Standort im jüdischen Viertel verfügt, der der jüdischen Gemeinde des Mittelalters gewidmet ist. An diesem Ort befinden sich Überreste der Synagoge, die bis zu ihrer Zerstörung während der ersten Wiener Gesera im Jahr 1421, einer Judenverfolgung durch Herzog Albert V., existierte.
Das Museum befindet sich im Misrachi-Haus am Judenplatz 8 und war bei unserem Besuch zu unserer Überraschung mit blau-weißen israelischen Flaggen geschmückt, die an den Fenstern hingen. Beim Betreten des Museums wird der Besucher von einem leeren Stuhl begrüßt, der an die Geiseln erinnert, die von der Hamas in Gaza nach den gewalttätigen Angriffen der Terrorgruppe im nordwestlichen Negev am 7. Oktober 2023 noch immer festgehalten werden.
Die jüdische Gemeinde im mittelalterlichen Wien wuchs auf etwa 900 Personen an, was 5 % der Gesamtbevölkerung der Stadt ausmachte. In dieser Zeit wurden die Juden als einzige geduldete religiöse Minderheit in Österreich anerkannt und erhielten bestimmte „Privilegien“. Mitte des 14. Jahrhunderts führte dieser Status jedoch zu einer Dämonisierung der jüdischen Bevölkerung, die sich mit dem Vorwurf des Wuchers konfrontiert sah, was zur Einführung neuer Gesetze führte, die ihre Mobilität einschränkten.
Trotz dieser Herausforderungen gab es im mittelalterlichen Wien mindestens zwei Synagogen, einen koscheren Metzger, ein rituelles Badehaus und ein Krankenhaus. Die Stadt entwickelte sich zu einem bedeutenden rabbinischen Zentrum in Aschkenas, der Region, die Nordfrankreich und das Rheinland umfasste und in der sich die Juden im Mittelalter zunächst niederließen und später aufgrund von Verfolgungswellen nach Mittel- und Osteuropa ausbreiteten.
Der erste namhafte Rabbiner Wiens war Itzchak bar Moshe, bekannt als Or Zarua, hebräisch für „Gesätes Licht“, nach seinem berühmtesten wissenschaftlichen Werk, das noch immer als wesentlicher Bestandteil der rabbinischen Literatur gilt.
Wiener Gasera
Wie bereits erwähnt, endete diese Periode jüdischen Lebens in Wien mit der ersten Gesera, einem Begriff, der sich aus dem jiddischen Bericht über die Verfolgung ableitet, während der die jüdische Gemeinde mit Morden, Ausweisungen, Verhaftungen und Zwangskonvertierungen konfrontiert war, sogar von Kindern unter 15 Jahren.
An Sukkot, dem 23. September 1420, begingen einige Juden lieber Massenselbstmord in der Synagoge, als zum Christentum überzutreten. Der als Jona bekannte Rabbiner tötete auf tragische Weise alle in der Synagoge anwesenden Männer und Frauen, bevor er sich selbst das Leben nahm.
Am 12. März 1421 wurden über 200 jüdische Überlebende - 92 Männer und 120 Frauen - auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Synagoge wurde niedergerissen und ihre Steine für den Bau der Universität Wien verwendet.
Klaus Lohrmann, ein Wiener Historiker und Gründungsdirektor des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, schilderte den erschütternden Moment an der Hinrichtungsstätte, als die Frauen in 86 Karren ankamen und die Flammen sahen, die ihr Schicksal bestimmen sollten:
Als die Frauen sahen, was mit ihnen geschehen sollte, begannen sie zu tanzen, als würden sie zur Chuppa geführt werden. Sie verherrlichten und heiligten seinen Namen, sehr zum Erstaunen der Schaulustigen. Erneut verkündete der Herzog, dass er diejenigen, die sich taufen ließen, mit Reichtum und Ehren belohnen würde. Er ließ ein Kreuz herbeibringen, damit sie ihm huldigen konnten. Doch sie bespuckten das Kreuz und den Herzog, weil sie glaubten, sie würden bald im Garten Eden sein. Als das Feuer brannte, verfluchten sie den Herzog und seinen Gott und lobten den Himmel. Aus dem Feuer heraus rezitierten sie „Shema Yisroel“ und „Möge Sein großer Name für immer und ewig gesegnet sein“.
Ein Wohnhaus am Judenplatz, das zwischen dem späten 15. und dem frühen 16. Jahrhundert erbaut wurde, weist eine Inschrift auf, die an die Ermordung der „hebräischen Hunde“ erinnert, wie sie die während der Wiener Gesara ermordeten Juden bezeichnet.
In der Neuzeit hat die Kirche ihre Rolle bei der Verfolgung der Juden in ganz Europa erkannt und deshalb eine Tafel an der Wand desselben Gebäudes angebracht, die die in der Inschrift zum Ausdruck gebrachte antijüdische Haltung verurteilt. Auf der Tafel heißt es: „Heute erkennt das Christentum seine Verantwortung für die Verfolgung der Juden an und ist sich seiner Unzulänglichkeiten bewusst.“
Während des gesamten Mittelalters waren die Juden in verschiedenen Regionen Österreichs und Europas brutaler Gewalt ausgesetzt, nicht nur durch marodierende Kreuzritter, sondern auch aufgrund des Vorwurfs der Blutverleumdung, wonach sie christliches Blut für ihre religiösen Zeremonien benötigten. Sie wurden auch des angeblichen Kaufs oder Diebstahls geweihter Hostien beschuldigt, was als Entweihung angesehen wurde, und wurden zu Unrecht für die Verbreitung der Pest verantwortlich gemacht, weil sie während des Schwarzen Todes angeblich Brunnen vergiftet hatten.
Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am 13. März 1938 markierte einen tragischen Wendepunkt für die 185.000 Juden, die der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) in Wien angehörten. Die jüdische Gesamtbevölkerung der Stadt könnte bis zu 200.000 betragen haben, was mehr als 10 % der Gesamtbevölkerung Wiens ausmacht. Vor dem Einmarsch des in Österreich geborenen Naziführers Adolf Hitler hatten nur Warschau und Budapest größere jüdische Gemeinden.
Angesichts der Unterdrückung durch die Nazis gelang es mehr als 120 000 Juden zu fliehen, während etwa 65 000 auf tragische Weise ermordet wurden. Nach der Befreiung der Stadt durch die sowjetische Rote Armee im Jahr 1945 zählte die IKG nur noch 3.955 Mitglieder. Derzeit zählt die Israelitische Kultusgemeinde Wien rund 8.000 Mitglieder.
Jüdisches Museum Wien
Adresse: Dorotheergasse 11
Nächstgelegene U-Bahn-Station: Stephansplatz (U1 oder U3)
In Wien wurde 1895 das erste jüdische Museum der Welt gegründet. In den 1920er Jahren nahm das Museum eine zionistische Perspektive ein, wurde aber 1938 von der Gestapo, der nationalsozialistischen Geheimpolizei, geschlossen. Der Leitung und den Mitgliedern des Museums drohte die Ausweisung oder Hinrichtung, während der Kurator Jakob Bronner noch im selben Jahr nach Palästina flüchtete.
Das Museum erzählt die Geschichte der zweiten jüdischen Gemeinde in Wien, die 180 Jahre nach ihrer Vertreibung im Jahr 1421 wiederhergestellt wurde. Ihre Rückkehr in die Stadt wurde durch den Bedarf des Kaisers an finanzieller Unterstützung erleichtert, insbesondere während des Dreißigjährigen Krieges von 1618 bis 1648. Diese zweite jüdische Gemeinde wurde 1624 offiziell gegründet, als Kaiser Ferdinand II. am 6. Dezember ein Patent erließ, das die jüdische Bevölkerung unter den Schutz des Hauses Österreich stellte. Für ihre Ansiedlung wies er ihnen einen Teil des Unteren Werds im zweiten Bezirk zu.
Bei der zweiten von drei Vertreibungen wurden die Juden 1669 durch ein Dekret des Kaisers Leopold I. vor allem aus wirtschaftlichen und religiösen Gründen aus Wien ausgewiesen, die eigentliche Vertreibung erfolgte 1670. Antisemitische Einwohner benannten das Gebiet, das einst als Judenviertel diente, ihm zu Ehren in Leopoldstadt um.
Die antijüdische Stimmung blieb in den habsburgischen Territorien weiterhin vorherrschend. Ein Beispiel dafür ist die Vertreibung von 20.000 Juden aus Prag durch Maria Theresia im Jahr 1744, die die letzte Vertreibung von Juden in Mitteleuropa vor 1933 war. Im Jahr 1777 äußerte sich Maria Theresia über die jüdische Gemeinschaft mit den Worten: „Ich kenne keine größere Plage als diese Ethnie, deren Betrug, Wucher und Geiz die Menschen zu Bettlern macht und die all jene schändlichen Geschäfte betreibt, die einem ehrlichen Menschen zuwider wären.“
Das Jüdische Museum Wien gibt Einblicke in die sephardische Gemeinde Wiens, die durch den Vertrag von Passarowitz 1718, einem Friedensabkommen zwischen den Habsburgern und den Osmanen, die Möglichkeit erhielt, sich in der Stadt niederzulassen und Handel zu treiben.
Türkische sephardische Juden genossen im Vergleich zu den etablierten aschkenasischen Gemeinden größere Privilegien, da sie Untertanen von Sultan Ahmed III. waren. Dazu gehörte auch das Recht, in Wien eine gesetzlich anerkannte Gemeinde zu bilden und eine Synagoge zu errichten. Die Gründung dieser sephardischen Gemeinde geht auf Diego d'Aguilar zurück, dessen Familie, die ursprünglich aus Portugal stammte, gezwungen war, zu einem anderen Glauben zu konvertieren, bevor sie zum Judentum zurückkehrte.
Im Jahr 1887 weihten die sephardischen Juden Wiens den neo-maurischen Türkischen Tempel ein, der an die Pracht der Alhambra in Granada erinnern sollte. Leider wurde diese Synagoge während der Reichspogromnacht 1938 von den Nazis zerstört.
Der Stadttempel, der 1826 eingeweiht wurde, entging der Zerstörung während des Nazi-Pogroms von 1938, weil er hinter einem Wohnhaus versteckt war. Er ist die einzige Synagoge der Stadt, die den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, da die Nazis die übrigen 93 Synagogen und jüdischen Bethäuser systematisch zerstörten.
Diese Synagoge war Zeuge bedeutender historischer Momente, darunter der 15. April 1949, als ein israelisches Passagierflugzeug erstmals in Österreich landete, um die sterblichen Überreste von Theodor Herzl, dem österreichisch-ungarischen jüdischen Journalisten und Wegbereiter des modernen politischen Zionismus, zur Umbettung nach Jerusalem zu bringen. Die sterblichen Überreste wurden am Vortag exhumiert und zum Stadttempel gebracht, wo sich eine große Menschenmenge versammelte, bevor die El Al-Maschine, eine Douglas DC-4, in Richtung jüdisches Heimatland abhob.
1981 wurde die Synagoge zum Schauplatz eines tragischen „palästinensischen“ Terroranschlags, der von zwei Mitgliedern der Organisation Abu Nidal (Fatah - Revolutionärer Rat) verübt wurde. Die mit Maschinengewehren und Handgranaten bewaffneten Angreifer zielten auf die Teilnehmer einer Bar-Mizwa-Zeremonie, töteten zwei Personen und verletzten 18 weitere, einige von ihnen schwer.
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl weiterer jüdischer Sehenswürdigkeiten in Wien:
Mahnmal gegen Krieg und Faschismus
Adresse: Augustinerstraße 8
Nächstgelegene Straßenbahnstation: Oper, Karlsplatz U (2)
Während des Einmarsches der Nationalsozialisten mussten zahllose jüdische Männer und Frauen pro-österreichische und antinazistische Schmierereien und Parolen von den Straßen und Gebäuden entfernen, während sich eine begeisterte Menschenmenge versammelte, um ihre Erniedrigung zu beobachten. Sie benutzten Bürsten und sogar ihre eigenen Zahnbürsten, um die Gehsteige zu reinigen. Die Skulptur mit dem Titel „Straßenwaschender Jude“ erinnert an diese Ereignisse und markiert den Beginn der nationalsozialistischen Verfolgung, die schließlich zur Deportation und Massenvernichtung der jüdischen Bevölkerung der Stadt führte.
Historische Markierung Feng Shan Ho
Adresse: Innere Stadt
Nächste U-Bahn-Station: Stadtpark (U4)
Dr. Feng Shan Ho, ein chinesischer Diplomat, der in den späten 1930er Jahren in Wien tätig war, spielte eine entscheidende Rolle bei der Rettung tausender Juden vor dem Holocaust, indem er ihnen Visa für Shanghai ausstellte. Bis 1939 hatten etwa 10 000 jüdische Flüchtlinge aus Österreich in Shanghai Zuflucht gefunden. Auf einer Gedenktafel an der Außenwand des Gebäudes, in dem er diese Visa ausstellte, steht: „Unter Missachtung der Weisungen seiner Vorgesetzten und unter Gefährdung seiner Karriere und persönlichen Sicherheit bewies er bemerkenswerten Mut, als viele andere versagten.“ In Anerkennung seines humanitären Engagements wurde Feng Shan Ho im Jahr 2000 von Yad Vashem in Jerusalem mit dem Titel Gerechter unter den Völkern geehrt.
Sigmund-Freud-Museum
Adresse: Berggasse 19
Nächste U-Bahn-/Straßenbahnstationen: Roßauer Lände (U4) oder Börse (1)
Besucher können das Wohnhaus besichtigen, in dem Sigmund Freud von 1891 bis 1938 lebte und arbeitete. 1938 war er gezwungen, nach England zu fliehen, wo er kurz darauf verstarb. Sein jüngstes Kind, Anna Freud, wohnte ebenfalls in diesem Haus und betrieb dort eine psychoanalytische Praxis.
Zu den zahlreichen ausgestellten Objekten gehört die „Israelitische Bibel“ (L. Philippson, 1841), die den Freuds als Familienbibel diente und in vielen fortschrittlichen, aufgeklärten jüdischen Haushalten zu finden war. Freud bezeichnete sich später als „gottloser Jude“ und verfasste 1939 das Werk „Moses und der Monotheismus“, das die Ursprünge des jüdischen Glaubens untersucht.
Café Landtmann
Adresse: Universitätsring 4
Nächstgelegene U-Bahn-/Straßenbahnhaltestellen: Rathausplatz, Burgtheater (1) oder Parlament (2) oder Schottentor U (U2)
Dieses historische Wiener Café wurde 1873 gegründet und hat im Laufe seines Bestehens zahlreiche renommierte jüdische Intellektuelle und Künstler willkommen geheißen. Zu den Persönlichkeiten, die das Etablissement besuchten, gehören die Komponisten Emmerich Kálmán und Gustav Mahler, Freud, der Schriftsteller und Dichter Peter Altenberg sowie der Autor, Literaturkritiker und Befürworter des Zionismus Felix Salten.
Wien Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI)
Adresse: Rabensteig 3
Nächstgelegene U-Bahn-/Straßenbahnhaltestellen: Schwedenplatz (U4) oder Schwedenplatz U (2)
Das Forschungsinstitut verfügt über ein kleines Museum, das das Leben und die Beiträge von Simon Wiesenthal würdigt. Nachdem er den Holocaust überlebt hatte, setzte er sich für Gerechtigkeit ein, indem er Nazi-Täter ausfindig machte und dafür sorgte, dass diese Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt wurden. Von seinem bescheidenen Büro in Wien aus untersuchte er etwa 3.000 Fälle von NS-Straftaten, von denen mehr als ein Drittel zu strafrechtlichen Ermittlungen führten. Zu seinen Ermittlungen gehörten namhafte Persönlichkeiten wie Adolf Eichmann, Franz Stangl und Josef Mengele.
Stolperstein (Holocaust Gedenksteine)
Während unseres Spaziergangs in der Nähe des Freud-Museums stießen wir auf mehrere Stolpersteine. Diese Gedenksteine, die in zahlreichen Städten in ganz Europa zu finden sind, markieren die letzten Wohnorte, Arbeitsplätze oder Bildungseinrichtungen von Juden und anderen von den Nazis verfolgten Personen. Das 1992 ins Leben gerufene Projekt wurde inzwischen auf über 70.000 Gedenksteine ausgeweitet, die in über 2.000 Städten und Gemeinden in 24 Ländern verlegt wurden.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung