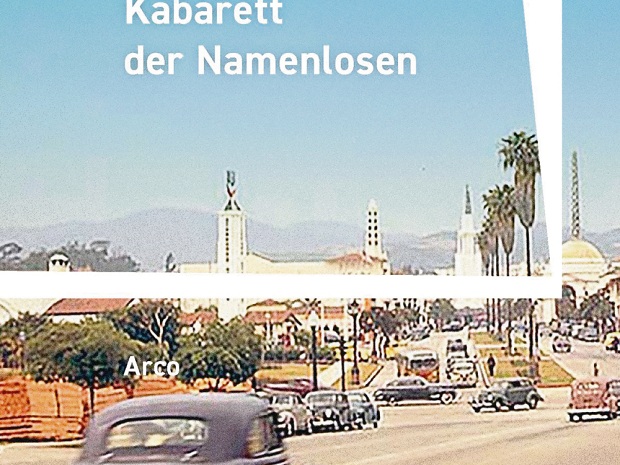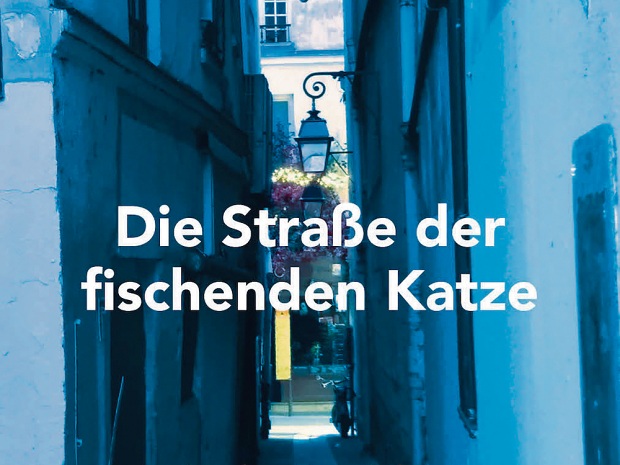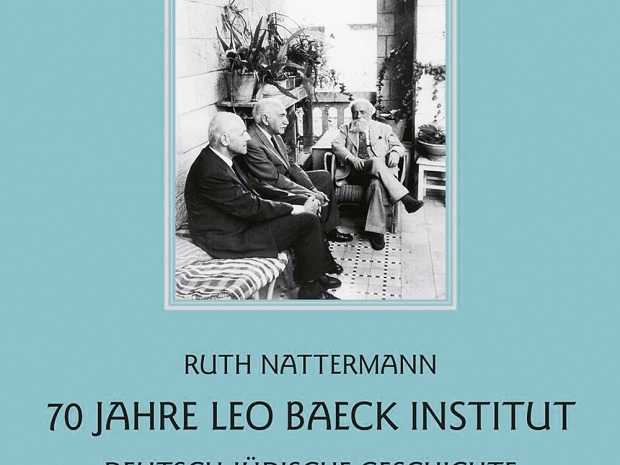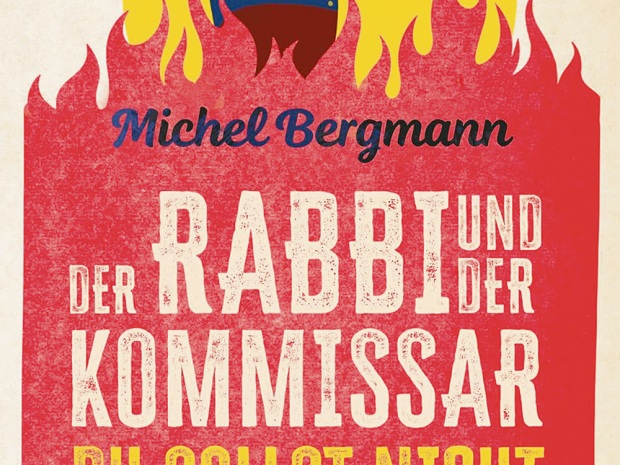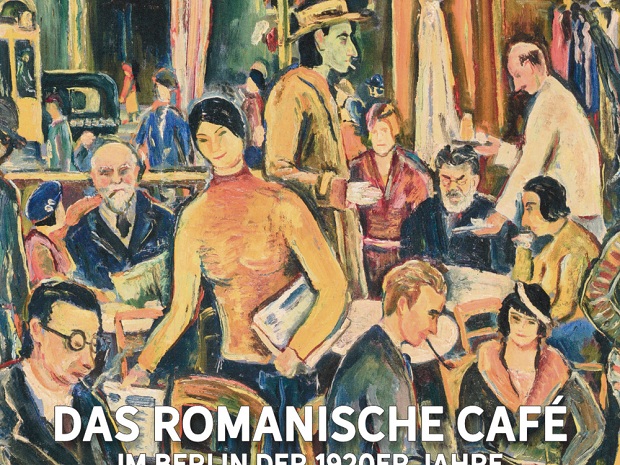Ausstellung: Kinder im Exil zwischen 1933 und 1945

Ausschnitt der Weltkarte, die die Exilländer zeigt, in die die Kinder reisten in der Ausstellung „Kinder im Exil“ in der Werkstatt Exilmuseum. Foto: Sabine Schereck
Die Ausstellung „Kinder im Exil“, ausgerichtet von der Akademie der Künste, ist derzeit in der Werkstatt Exilmuseum in Berlin zu sehen. Sie zeichnet 26 Erfahrungen von Kindern renommierter Künstler nach, deren Nachlässe sich im Archiv der Akademie der Künste befinden. Darunter sind Kinder, die selbst Berühmtheit erlangten wie Judith Kerr, Barbara Brecht-Schall oder Konrad Wolf, aber auch solche, die beruflich andere Wege gingen als ihre Eltern und denen ihr Exilland zur Heimat geworden war, wie Eva und Peter Dessau, die Kinder des Komponisten Paul Dessau, der in die USA emigrierte. (JR)
In ein anderes Land zu reisen kann aufregend sein. Es ist vielfach ein neues Land, auch fremdes Land mit einer Sprache, die man nicht versteht. Als Schützling von Eltern, die ins Exil müssen, ist es kein Urlaub. Da ist die Einordnung in eine Schulklasse. Schließlich müssen Rechnen, Schreiben, Lesen etc. weiter gelernt werden. Man kommt in eine Gruppe Kinder, die eins sind mit der sie umgebenden Kultur. Man selbst ist ein Fremdling. Wenn man Glück hat, wächst man in die Gruppe und Kultur hinein. Dann heißt es abermals „Auf Wiedersehen“, wenn die Eltern gezwungen sind weiterzuziehen.
Die Ausstellung „Kinder im Exil“, ausgerichtet von der Akademie der Künste, ist nun in der Werkstatt Exilmuseum in Berlin zu sehen. Sie zeichnet 26 Erfahrungen von Kindern renommierter Künstler nach, deren Nachlässe sich im Archiv der Akademie der Künste befinden. Darunter sind Kinder, die selbst Berühmtheit erlangten wie Judith Kerr, Barbara Brecht-Schall oder Konrad Wolf, aber auch solche, die beruflich andere Wege gingen als ihre Eltern und denen eines der Exilländer zur Heimat geworden war, wie Eva und Peter Dessau, die Kinder des Komponisten Paul Dessau, der in die USA emigrierte. Eva und Peter blieben dort; sie arbeitete als Germanistin, er wurde Metallingenieur. Auch Marty und Peter Grosz, die Söhne des Malers George Grosz, blieben in dem Land. Marty etablierte sich als Jazzmusiker, Peter schlug eine Laufbahn als Luftfahrthistoriker ein. Pierre (Peter) und Ruth Radványi, die Anna Seghers zur Mutter hatten, führte das Exil nach Frankreich und später nach Mexiko. Beide kehrten nach Frankreich zurück, wo er Physiker wurde und sie Medizin studierte. Ruth nahm ihr Wissen schließlich in die DDR, wohin ihre Mutter Anna Seghers nach dem Krieg gezogen war. Blickt man auf die Lebensläufe derer, die nach Deutschland zurückkehrten, dann findet sich vielfach die DDR als Adresse. Damals war das Land Hoffnungsträger für eine bessere Gesellschaft: mehr soziale Gerechtigkeit und frei von Antisemitismus. Die Rückkehrer waren politisch links und/oder jüdisch.
Verschiedene Stationen des Exils
Als Kind ins Exil zu gehen, bedeutete mehr als neue Sprachen und Mitschüler. Als jüngeres Kind waren da oft noch die schützenden Hände der Eltern, die die bittere Realität und Gefahren nicht spüren ließen. Judith Kerr war 9, als sie Berlin verließ. Erst ging es 1933 in die Schweiz, dann nach Frankreich und 1936 weiter nach England, wo sie heimisch wurde. In Interviews erzählte sie oft von einer Erinnerung in Paris. Sie blickte gemeinsam mit ihrem Vater über die Dächer der Stadt und soll zu ihm gesagt haben: „Ist es nicht herrlich, ein Flüchtling zu sein!” Sie empfand die Erfahrung, in verschiedenen Ländern zu leben, als aufregend.
Ältere Kinder hingegen wurden schneller erwachsen, da es galt, Verantwortung zu übernehmen. Das war bei Peter Radványi der Fall. Er kam 1933 mit 7 Jahren mit seiner Familie nach Frankreich. Nach anfänglichen Problemen in der Schule, da er als Emigrantenkind von Mitschülern gepiesackt wurde, brachte ein Schulwechsel Besserung. Der Einmarsch der Deutschen in Paris 1940 stürzte das gerade gewonnene Gleichgewicht ins Chaos. Sie mussten sich in Paris verstecken und ihm gelang es noch, Gegenstände aus der zurückgelassenen Wohnung zu holen. Später schafften sie es über Marseille nach Mexiko. Auch George Wyland-Herzfelde war 14, als er für sich die Verantwortung übernehmen musste. Er war der Sohn von Wieland Herzfelde, dem Leiter des Malik-Verlags, der politische, vornehmlich kommunistische Texte sowie Avantgardkunst veröffentlichte. Die Herzfeldes mussten 1933 ebenfalls die Flucht ergreifen. Doch bevor die Entscheidung auf Prag fiel, wurde George bereits bei seinen Großeltern in Salzburg in Verwahrung gegeben. Später wurde er nach Prag geholt. Ab 1938 war es auch dort zu riskant und New York wurde in den Blick genommen. Während die Familie in Paris und London die Emigration in die USA fürs Frühjahr 1939 vorbereitete, sollte George in der Schweiz weiter zur Schule gehen. Ihm hatte man auch die spärlichen Ressourcen der Familie in Form einer wertvollen Briefmarkensammlung mitgegeben.
Der Flug von Prag nach Genf, den er als 14-jähriger alleine antrat, war ein Abenteuer. In der Broschüre zur Ausstellung heißt es: „An der Flughafenkontrolle hielt er einen ausgestopften Vogel in der Hand, der die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zog. Sein Briefmarkenalbum hielt er versteckt unter dem Arm.“ Diese Sammlung bildete dann in New York den Grundstock für einen Briefmarkenladen, mit dem der Vater die Familie erstmal über Wasser halten konnte. Rückblickend sagt Wyland-Herzfelde: „Mehrmals wurde ich, gegen meinen Willen, vorweg in Sicherheit gebracht. Ob, wann und wo wir uns wiedersehen würden, war damals niemals sicher.“ George zeichnete jedoch noch andere Facette aus: Seine Hingabe zum Schlittschuhlaufen. Als seine Eltern 1933 an den Wannsee zogen, lernte er es mit 8 Jahren. In Prag beginnt er ernsthaft zu trainieren und in den USA wird es zum Beruf neben der Arbeit als Werbefachmann.
„Patchwork-Schulbildung“
Für Stefan Benjamin, den Sohn des Philosophen Walter Benjamin, war das höchste Ziel das Abitur, um studieren zu können, aber die politischen Umwälzungen in Europa ließen seine Schulbildung zur Odyssee werden. Seine Eltern Walter und Dora Sophie lebten 1933 bereits getrennt. Die Beziehung zu ihnen war lose, so machte es ihm nichts aus, bis 1935 allein in Berlin zu bleiben, während Walter bereits in Südfrankreich und Dora in Italien war. Er war 17. 1936 ging er nach Wien, um dort etwas mehr Sicherheit zu finden. Die Schule abschließen konnte er jedoch nicht, bevor die Deutschen 1938 Österreich annektierten. Er floh zu seiner Mutter nach Italien und ging dort weiter zur Schule bis beide Anfang 1939 nach England übersiedelten. Dort war sein Ziel zum Greifen nah, da er die Aufnahmeprüfung zur Universität bestanden hatte. Doch mit Kriegsausbruch wurden Deutsche als ‚feindlich Ausländer’ interniert. Schlimmer noch: Stefan gehörte zu denen, die die Engländer aus ihrem Land schafften und er wurde 1940 per Schiff nach Australien transportiert. Erst 1946 konnte er zurück nach Großbritannien, wo er als Buchhändler tätig war.
Solch eine Patchwork-Schulbildung war nicht einfach, doch gegenüber den Kindern, die in Deutschland zurückgeblieben waren, brachte sie einige Vorteile: Sie wurden nicht von der NS-Ideologie indoktriniert und die Erfahrung verschiedener Länder erweiterte ihren Horizont. Sie brachte eine Bildung, die keine Schule hätte leisten können.
Dank der von Gesine Bey kuratierten Ausstellung erfährt der Besucher von Kindern berühmter Eltern, von denen man hierzulande kaum etwas weiß, wenn sie im Exilland verblieben.
Was die Ausstellung zudem von anderen zum Thema Exil unterscheidet, ist, dass sie sich an Kinder richtet. Das bedeutet auf praktischer Ebene, dass Informationen in kleinen Häppchen dargeboten werden und über dreidimensionale Module, anstelle bloßer Tafeln. Die Module reflektieren je ein Exilland. Darunter Großbritannien, Frankreich, Schweiz, Tschechoslowakei, Sowjetunion, Palästina, Mexiko und die USA. So kann man entdecken, wer welches Land durchreist hat. Allerdings vermisst man dort zuweilen zusammenhängende Fäden der Biografien, was letztlich aus den Kindern geworden ist. Dazu muss man sich auf eine anderswo ausgestellte Tafel beziehen.
Für Kinder konzipiert, öffnet die Ausstellung auf ideeller Ebene gleich mehrere Türen. Zum einen ist sie eine Annährung an einen Teil der deutschen Geschichte, zum anderen vermittelt sie, was Exilerfahrung bedeutet – ein Thema, das heute noch aktuell ist, bedenkt man die vielen Kinder mit Migrationshintergrund. Sie ermöglicht früh mehr Empathie und Toleranz gegenüber ‚anderen’ zu entwickeln und damit hoffentlich Fremdenhass und Gewaltbereitschaft zu reduzieren. Die Ausstellung läuft bis 1. November 2024.
Weitere Einblicke ins Exil bietet danach die empfehlenswerte Lesung am 14. November in der Werkstatt des Exilmuseums: „Nachrichten aus dem Exil. Texte zu Kunst und Exil aus den Archiven der Akademie der Künste 1933 bis 1945”.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung