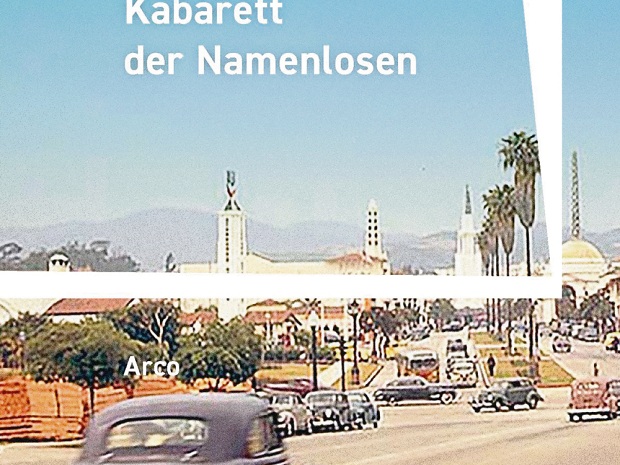Das Jüdische Museum Berlin mit „Paris Magnétique. 1905-1940“
.jpg)
Eingangsbereich der Ausstellung© Sabine Schereck
In der Ausstellung geht es um Paris als Anziehungspunkt für internationale Künstler und der daraus hervorgegangenen „École de Paris“. Der Fokus liegt auf der immensen Bereicherung der französischen Kulturszene durch die jüdischen Künstler, die primär vor dem Ersten Weltkrieg ihren Weg in die Stadt fanden. Sie kamen vor allem aus Mittel- und Osteuropa – unter ihnen auch Marc Chagall. Die jüdische Emigration nach Frankreich wurde durch die Machtübernahme der Nazis in Deutschland jäh gestoppt. (JR)
Die Berlinische Galerie zeigte mit der Ausstellung „Magyar Modern. Ungarische Kunst in Berlin 1910–1933” wie ungarische Künstler die Berliner Kultur bereicherten. Insbesondere nach 1919 als sie in ihrer Heimat politisch verfolgt oder aufgrund ihrer jüdischen Religion ausgegrenzt wurden.
Eine andere Migrationsbewegung in der Kunstgeschichte greift nun das Jüdische Museum Berlin (JMB) mit „Paris Magnétique. 1905-1940“ auf. In der Ausstellung geht es um Paris als Anziehungspunkt für internationale Künstler und der daraus hervorgegangenen „École de Paris“, der Pariser Schule. Der Begriff beschreibt die kosmopolitische Künstlergemeinschaft der Zugezogenen, für die Paris nicht nur eine Art Schule war, sondern auch zur Heimat wurde und dessen Kunstszene sie prägten.
Die Ausstellung hat selbst eine Reise hinter sich. Sie war 2021 im Musée d'art et d'histoire du Judaïsme in Paris unter dem Titel „Chagall, Modigliani, Soutine. Paris pour école, 1905-1940“ zu sehen. Der Name verrät bereits, welch bekannte Größen der Gemeinschaft angehörten. Pascale Samuel hat die Schau kuratiert und die Kuratorin des JMB Shelley Harten hat sie für Berlin adaptiert. Gekommen sind etwa 140 Werke von 33 Künstlern, die in zehn Kapiteln von der École de Paris erzählen: ihren Anfängen, ihren Orten, ihren Künstlern, ihren Themen sowie ihren Kunstströmungen und was Paris so besonders machte.
Paris als Zufluchtsort
Paris war, wie Berlin, ein Zufluchtsort, doch die Stadt war bereits um 1900 eine Kunstmetropole mit kosmopolitischem Flair. In ihren Straßen wehte ein freier Geist, in denen neue künstlerische Trends gedeihen konnten und Neuankömmlinge aus der Ferne nicht auffielen. Wer seine künstlerische Karriere voranbringen wollte, ging nach Paris. Die Avantgarde mit Werken des Fauvismus, Kubismus, Konstruktivismus und Expressionismus füllten damals die Pariser Galerien und hier den ersten Raum. Zu sehen sind Sonia Delaunays abstraktes „Elektrisches Prismen, Nr. 41” (1913/14) oder Alice Halickas „Kubistisches Stillleben” (1915). Der Fokus der Ausstellung liegt auf jüdischen Künstlern, die primär vor dem Ersten Weltkrieg ihren Weg in die Stadt fanden. Sie kamen vor allem aus Mittel- und Osteuropa.
Unter ihnen der Ungar Béla Czóbel. Wer in „Magyar Modern“ die leuchtenden Farben seiner vom Fauvismus geprägten Topfpflanze bewundert hat, dem wird hier seine Pariser Zeit in Erinnerung gerufen, repräsentiert durch sein farbenfrohes Gemälde „Maler auf dem Lande“ (1906). Er gehörte zur ersten Generation der Ankommenden in Paris. Darunter waren interessanterweise auch Deutsche wie der Maler Walter Bondy, der an der Seine Inspiration suchte. Um sie herum gesellten sich später Künstler verschiedenster Herkunft, die über die deutsche Sprache verbunden waren: viele von ihnen hatten zuvor in Berlin, in Karlsruhe oder vor allem in München studiert. So auch Czóbel. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges musste er Frankreich verlassen. Er verweilte bis 1919 in Holland und zog dann nach Berlin, wo er seine „Berliner Straße“ (1920) malte.
Während in „Magyar Modern“ Bilder zu sehen waren, die eine künstlerische Auseinandersetzung mit Berlin zeigten, taucht Paris als Motiv kaum bei den hier präsentierten Künstlern auf.
Jiddisch mit Chagall
Eine Ausnahme bildet Michel Kikoïnes „La Ruche im Schnee“ (1913). Das Bild zeigt das Künstlerhaus La Ruche und fällt auf, da viel Zuneigung mitschwingt. Als Kikoïne 1912 mit 20 Jahren nach Paris kam, lag seine Heimat in weiter Ferne. Er war im Russischen Kaiserreich aufgewachsen, wo Juden Pogromen ausgesetzt waren. Mit wenigen Talern in der Tasche richtete er sich im La Ruche ein. Dort konnte man günstig Ateliers mieten und es war für viele Neuankömmlinge die erste Adresse. Die Ausstellung begleitet den Besucher an diesen besonderen Ort, der gewissermaßen auch Geborgenheit bot. Die Künstler waren nicht allein, sondern in guter Nachbarschaft anderer Künstler, die schon Netzwerke in der Stadt hatten. So fand Kikoïne bereits Chagall dort vor, mit dem er sich auf Jiddisch austauschen konnte. Er war nicht der einzige. Ein paar Türen weiter arbeiteten Moïse Kisling, Léon Indenbaum und Chaïm Soutine. Sogar Amadeo Modigliani war Gast.
Sie und viele andere Namen finden sich auf einer Grafik, die die Künstler des La Ruche illustriert. Die Grafiken an den verschiedenen Stationen der Ausstellung gehören zu den Stärken der Schau. Sie machen die vielen Verknüpfungen zwischen den Künstlern sichtbar sowie die Zeiträume, in denen sie ankamen und welche künstlerischen Strömungen ihnen nahe waren. Die Grafiken bieten eine gute Orientierung in dem vielfältigen Wirken der Künstler und ihren verflochtenen Beziehungen.
Das La Ruche war zwar praktisch, aber nicht perfekt und wer sich in der Pariser Gesellschaft integriert hatte, zog weiter. Ein wichtiges Ereignis dabei bildete der Erste Weltkrieg. Kikoïne und Kisling traten der Fremdenlegion bei, um Frankreich zu unterstützen und ihre Verbundenheit zur ihrer neuen Heimat zu zeigen. Beide erhielten später die französische Staatsbürgerschaft.
Die 1920er-Jahre brachten eine Zeitenwende. Stand bisher die Identität als Künstler im Vordergrund, rückte mit dem Zustrom weiterer Künstler von außerhalb ihre Nationalität in den Blick. 1923 beschloss der Salon des Indépendants, die Künstler mit ihren Werken nicht mehr alphabetisch, sondern nach Nationalität zu präsentieren. Um dieser Fremdenfeindlichkeit entgegenzuwirken, prägte der Schriftsteller André Warnod 1925 die Bezeichnung „École de Paris“ für die ausländischen Künstler, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Paris kamen und die Kunstszene maßgeblich beeinflussten.
„Die jüdische Renaissance“
Zur gleichen Zeit war dies für einige Künstler Anlass, sich mit ihrer jüdischen Herkunft auseinanderzusetzen. Im Abschnitt „Die jüdische Renaissance“ holt die Ausstellung Publikationen hervor, die sich mit jüdischer Kultur beschäftigten. Sie erschienen auf Hebräisch, wie das erste jüdische Kunstjournal „Makhmadim”, auf Französisch, wie die Zeitschrift „Menorah” oder auf Jiddisch wie die Buchreihe „Les artistes Juifs”.
In der Kunst ist der Trend bei Alice Halicka und Mané Katz ablesbar. Stilistisch lässt Halicka den Kubismus hinter sich, reist 1921 in ihre Heimat Krakau zurück und hält Szenen des jüdischen Viertels im folkloristischen Stil fest wie in „Jüdisches Fest” (1921). Katz, aus der Ukraine stammend, widmete sich ebenfalls dem Stetl. Sein „Jüdischer Student” (1927) mit seiner prägnanten geschwungenen Linienführung bleibt im Gedächtnis. Während Katz ab 1928 regelmäßig nach Palästina fuhr, war Halickas Beschäftigung mit der jüdischen Kultur nur vorübergehend. Später entwarf sie Kostüme und Bühnenbilder in London und New York.
Das viele Reisen und der kosmopolitische Lebensstil kennzeichneten die Künstler, gerade in den 1920er-Jahren, in der die Kunstszene und das Nachtleben in Paris vibrierten. Viel Dynamik herrscht in den farbigen Pastellen des Weltenbummlers Jules Pascin und in den Skizzen der Malerin Lou Albert-Lasard, die einen guten Eindruck der Tanzbars und dem amüsierfreudigen Publikum vermitteln. Beides waren schillernde Figuren der Pariser Bohème mit filmreifen Biografien.
Später kehrt Ruhe in die Bilder, etwa bei Kislings „Frau mit polnischem Schal“ (1928). Seine klare Linienführung und Farbgebung reflektieren den für die Zeit typischen Stil der Neuen Sachlichkeit. Das Bild aber erzählt mehr: Der polnische Schal mit dem farbigen Blumenmuster ist eine Referenz an seine Heimat Krakau und die Augen der Frau sind voll Melancholie. Sie besitzt eine Anmut, die unter den gezeigten Portraits kaum zu finden ist.
Die 1930er Jahre sind hier als Vorahnung dargestellt: Der Einmarsch der deutschen Truppen 1940 setzt dem freiheitlichen Geist Paris’ ein Ende. Den jüdischen Künstlern der École de Paris droht die Deportation sofern sie nicht ins Ausland oder in den Untergrund fliehen. Auf der letzten Wand drängen sich dicht Schwarzweißfotos ihrer Werke, die die Nationalsozialisten vernichtet haben. Es ist ein sensibel gestalteter Abschluss, der die reichen, lebendigen vorangegangen Eindrücke beim Besucher nicht erdrückt, sondern weiter atmen lässt.
Die Ausstellung öffnet ein Fenster zu einem faszinierenden Bereich der Kunstgeschichte. Zudem beweist sie Aktualität und Bedeutung. Migration ist keine neue Erscheinung, aber die École de Paris bietet ein gutes Beispiel dafür, wie Anregung von außen, Integration und liberale Geisteshaltung ein kulturelles Miteinander ermöglichen, bei der die Herkunft des Einzelnen nicht relevant sein muss.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung