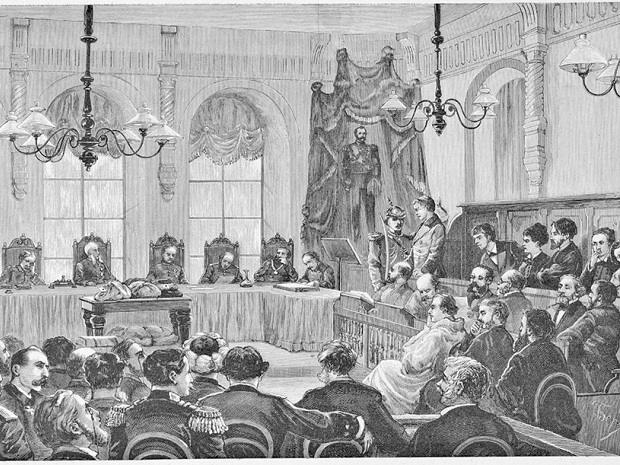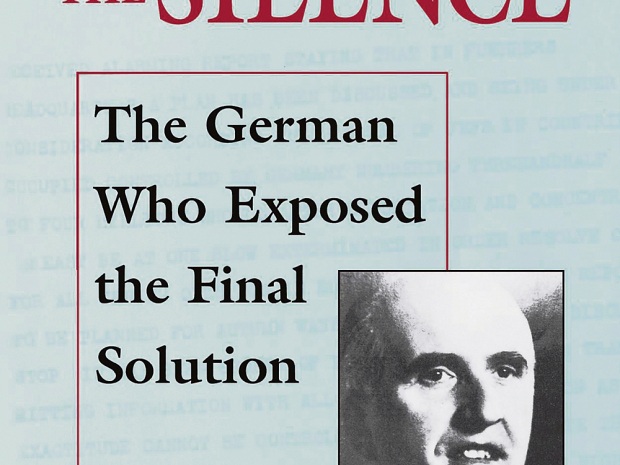Der authentische jiddische Humor der Orthodoxen
Die Fernsehserie „Shtisel“ aus Israel kommt ohne Klezmer-Klischees und ohne Verurteilung der Orthodoxie aus. Gespräche zwischen orthodoxen Juden in authentischem Jiddisch zeigen dem Publikum wie sich realer, scharfzüngiger jüdischer Humor tatsächlich anhört.
Auf einer Parkbank schimpfen sie über schmutzige Badezimmer in der Lobby des Altersheimes. „Hast du deshalb geweint?“, fragt Großmutter Shtisel Rebbezin Eblich. „Hast du mich jemals weinen gesehen? Ich habe nicht einmal geweint, als mein Mann den Löffel abgegeben hat“, antwortet Eblich bissig.
Es darf laut gelacht werden, über jüdisch-orthodoxe Weisheiten und über das Leben. Frauen und Männer haben zwar zugewiesene Rollen, nichts hindert sie jedoch daran, sich über alles zu amüsieren, auch über tote Ehemänner.
Über Akiwa Shtisels Interesse an der zweifachen Witwe Elisheva ist der Heiratsvermittler entsetzt: „Sie ist wie ein eingefrorenes, aufgetautes und aufgewärmtes Schnitzel. Eingefroren, aufgetaut und in der Mikrowelle aufgewärmt. Serviert auf einem Pappteller“, so Kenigsberg.
Mit „Shtisel“ ist Ori Elon und Yehonatan Indursky ein einfühlsam-humorvoller Einblick in das ultra-orthodoxe Judentum gelungen. Die Serie kommt auf leisen Sohlen daher, ohne jegliche Action oder Anzüglichkeiten aus und ist dennoch ein Publikumserfolg des Streaming-Dienstes Netflix, von dem schon bald eine dritte Staffel folgen wird.
Es ist ein Glücksfall, dass die Serie deutsch untertitelt ist, was dazu beiträgt, die Lebenswelt ultra-orthodoxer Juden authentisch abzubilden, da ein ständiger Wechsel von Jiddisch zu Hebräisch stattfindet. Ein Ohrenschmaus für Kenner beider Sprachen und für jene, die es werden wollen. Dem synchronisationsverwöhnten deutschen Zuschauer wird zwar Einiges abverlangt, doch mit der Konzentration auf dieses Wechselspiel ungewohnter Sprachen taucht man in die Welt der strenggläubigen Juden Jerusalems ein.
Der Thora- und Talmudlehrer Shulem Shtisel (der Vater von Akiwa) liebt seine Kinder. Giti, die von ihrem Mann kurzzeitig wegen einer Schickse verlassen wurde, versucht er zu trösten, wie ein Vater eine kleine Tochter tröstet: er schneidet Grimassen. Die Menschlichkeit hinter dieser Szene ist ergreifend, weiß doch der Zuschauer, dass Shulem nichts vom Seitensprung des Schwiegersohnes ahnt, da Giti alles für sich behält, woran sie innerlich zu zerbrechen droht.
Detailliert ausgearbeitete Figuren
Orthodoxe Juden werden mitnichten als eine amorphe, schwarze Masse dargestellt, in der das Individuum nichts zählt. Die Figuren sind feinsinnig, liebevoll und detailliert ausgearbeitet. Die Alltagsthemen sind nur allzu menschlich, sie handeln von unglücklicher Liebe, verpassten Chancen, Verletzungen, zu hohen Eigenerwartungen und neuen Lebensentwürfen. Wie im wahren Leben.
Nur, dass hier das wahre Leben durch religiöse Ge- und Verbote festgelegt ist. Ehen werden arrangiert und erfordern die Zustimmung der Eltern. Beim Kennenlernen sind Eltern und der Rest der Sippschaft anwesend. Man feiert mit Kuchen eine bevorstehende Verbindung, aber der potentielle Bräutigam muss der Braut auch gefallen.
Shulem Shtisel ist Witwer. Mit seinem jüngsten Sohn Akiva, liebevoll Kive genannt, lebt er ein fast symbiotisches Leben in einer kleinen Wohnung. Ihre Lebensweise ist einfach und bescheiden. Aus den deutschen Wohnzimmern blicken die Zuschauer in einen bislang eher verborgenen Part des Judentums, abseits von Politik und Nahostkonflikt. Man begegnet sympathischen Menschen, deren Anziehung sich das Publikum kaum entziehen kann.
Wenn da nur Akivas „Defekt“ nicht wäre, der der eigentliche Plot der Geschichte ist. Akivas sogenannter Defekt ist seine verträumte Art, die auf seine Umgebung wunderlich wirkt. Er hängt mit seinen Kumpels Pinchik und Farshlufen herum, und ist obendrein auch noch Künstler. Malen und Zeichnen sind seine Bestimmung. Er sei nicht „ernsthaft“, wie ihm Cousine Libbie zu seiner Verwunderung attestiert, und mit 27 Jahren längst im heiratsfähigen Alter. Als Kive sich in die gleich zweifache Witwe Elisheva verliebt, sind alle potentiellen Brauteltern nicht einverstanden. Shulem lehrt seinen Sohn: „Du musst wissen, wann du den Verstand und wann du das Herz einsetzen musst.“
Selbst Elisheva will die Verbindung nicht so recht. Behutsam wird dem Zuschauer in einem intimen Moment der Grund verraten, als sie vor Akiva ihre Perücke abnimmt, sehen wir erste graue Haare. Sie ist älter und hat mit bereits zwei Ehen schon etwas hinter sich. Mit Akiva will sie zusammenleben, aber gleich heiraten? Auch das ultra-orthodoxe Leben erfährt Brüche.
Nach Akivas erster Entlobung, steigen seine Chancen für eine Verbindung mit Elisheva enorm. Einer Heiratsvermittlerin erklärt Shulem, sein Sohn sei „defekt und braucht eine defekte Frau.“ Natürlich habe er anfangs eine „normale Frau“ für seinen Sohn gewollt, aber jetzt, wo sein Ruf ruiniert ist und er nur zweitklassige Ware ist – warum nicht?
Akiva sitzt gerne draußen auf dem Balkon des etwas heruntergekommenen Wohnblocks und beobachtet Menschen. Vater und Sohn rauchen viel und das gemeinsame Essen als wiederkehrendes Motiv betont ihre innige Vertrautheit, während sie Weißbrot und israelischen Salat essen.
Korsett oder doch eher Herzensruhe?
Das Shtisel-Publikum blickt in eine Welt, in der kein Bissen gegessen und kein Schluck getrunken wird ohne dem Allmächtigen dafür ein Dankgebet zu sprechen.
Wir sehen keine verklärten Geschichten à la Scholem Alejchem oder Chagall, die ein vergeistigtes Leben beschreiben, wo man Schabbat-Lichter anzündet, und arm aber fröhlich ist. Zum Duschen muss der Boiler rechtzeitig angeschmissen werden und Liebe ist, dem Ehepartner die Butter rechtzeitig aus dem Kühlschrank zu holen, damit sie nicht zu hart ist.
Hitzig diskutiert man in Jiddisch, jener klangvollen und wortmächtigen Sprache der Ostjuden, die sich hervorragend eignet, Dinge auch im Leisen pointiert auszudrücken. Sie ist aber die Sprache der älteren Generation. Spricht Shulem vom Essen und verwendet dabei wortgewaltig und schnalzend Worte wie Geschmack oder die Allzweckwaffe Nunu, wird die Nähe des aschkenasichen Jiddisch zur deutschen Sprache dem Publikum allgegenwärtig.
In Corona-Zeiten ist Shtisel Israelfreunden zum Israelersatz geworden. Man wird schnell zum Wiederholungstäter, denn die Serie hat Suchtpotential. Mit jedem Kameraschwenk kann man die Atmosphäre Jerusalems in sich aufsaugen, bekommt Appetit auf Tomaten-Gurkensalat und meint den Duft von Hühnersuppe zu riechen.
Wer erfahren will, was mit Männern geschah, die das aufgetaute Schnitzel aßen, dem sei Shtisel ab Staffel eins wärmstens empfohlen.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung