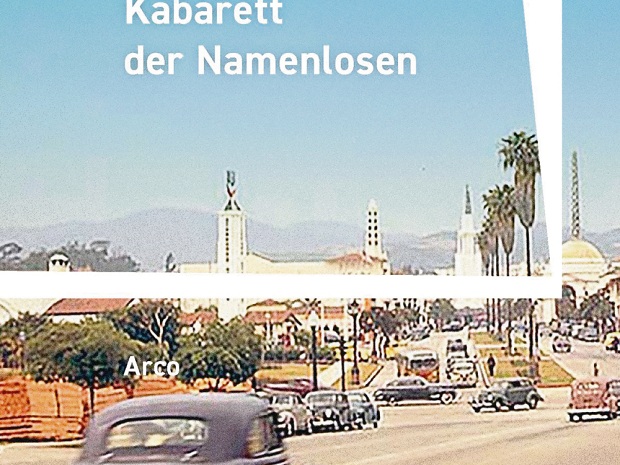Viele Polen suchen nach ihren jüdischen Wurzeln
Innerhalb von nur zehn Jahren hat sich in Polen die Zahl der sich als Juden definierenden Menschen verachtfacht.

Junge Polin bei Aufräumarbeiten auf einem jüdischen Friedhof© JANEK SKARZYNSKI, AFP
Die genaue Adresse wird nicht genannt. Im Internet heißt es lediglich: „In Warschau, nahe Zgoda-Straße“. Es handelt sich um das erste polnische Moses-Haus – etwas zwischen Bürgerzentrum und Herberge. Dort wohnt eine Gruppe junger polnischer Juden, viele davon Studenten. Sie feiern gemeinsam Schabbat, organisieren Gesprächsrunden mit einem Rabbiner oder den Professoren der Uni. „Das ersetzt uns ein jüdisches Heim“, erzählt Helena, die Judaistik studiert. „Die meisten von uns konnten keine Erziehung im Geiste der jüdischen Tradition genießen, unsere Eltern pflegten sie nicht.“
Es gibt kein Schild an der Eingangstür – aus zweierlei Gründen: Zum einen der Sicherheit wegen, zum anderen, damit das Private auch privat bleibt. „Das ist unser Zuhause“, betont Helena. Sie seien auch für ihre Freunde da, offen für sie – und viele dieser Freunde seien nicht jüdisch. Das Moses-Haus und das jüdische Thema allgemein weckt Interesse, die Veranstaltungen im Haus sind sehr populär. Es entspricht in einer gewissen Art dem Zeitgeist, sich für das Judentum zu interessieren; Helena ist froh darüber, schließt jedoch nicht aus, dass dies für viele nur ein Hobby ist.
Die vor Kurzem durchgeführte Volkszählung zeigt: In Polen leben etwa 8.000 Juden. Das ist nicht viel für ein Land, das vor dem Zweiten Weltkrieg drei Millionen Juden zählte. Wenn man allerdings diese Zahl – 8.000 – mit den Ergebnissen der vorherigen Volkszählung, die neun Jahre zurückliegt, vergleicht, dann ist der Unterschied groß: Vor neun Jahren bezeichneten sich lediglich 1.133 Menschen als Juden. Anna Schyba, die Mitarbeiterin des Zentrums der jiddischen Kultur bei der Stiftung „Schalom“, erklärt: „Dieses Wachstum ist ein Effekt der dritten Generation. Die erste Generation bildeten die Holocaustopfer und -überlebende; die zweite – die nach dem Krieg Geborenen, deren Eltern Zeitzeugen waren. Diese beiden Generationen wollten ihr Trauma um jeden Preis vergessen. Die heutigen 20 – 30-jährigen haben keine traumatischen Erinnerungen. Sie beginnen Fragen zu stellen, ihre familiäre Geschichte ist für sie interessant, aber nicht so belastend; oft helfen sie ihren Eltern und Großeltern ihre Identität wiederherzustellen.“
Die verlorenen Generationen
So ist es der Restaurantbesitzerin aus Warschau, Malka Kafka, ergangen, die erst nach dem Tod ihres Großvaters von ihren jüdischen Wurzeln erfuhr. Zufällig fand sie seine Ausweispapiere aus dem Lager und die unbekannten Fotos. Bereits früher hörte Malka zuhause Gesprächsfetzen, sie seien mit dem Schriftsteller Franz Kafka verwandt, aber damals, als rebellierender Teenager, interessierte sie sich nicht für ihre Vorfahren. Malka erzählt: „Eines Tages besuchten mich Freunde aus Israel und wollten den Rabbiner der Warschauer Reformsynagoge kennenlernen. Ich kam eher aus Höflichkeit mit und spürte dort plötzlich: Das ist Meins! Gijur (Konversion) dauerte über ein Jahr. Ich war enthusiastisch wie ein frisch Verliebter: Ohne jede Kritik, verblendet. Hebräisch lernen, Kaschrut studieren, Schabbat feiern… Nach drei Jahren kam die Krise.“ Heute, sagt Malka, sei ihre Beziehung zum Judentum einer gereiften Liebe ähnlich: Tief und reflektierend.
Bei dem Journalisten Andrzej Morosowski hingegen entwickelte sich trotz der Information über seine jüdische Herkunft kein religiöses Interesse. Als Schuljunge fand er zuhause Papiere mit den „komischen“ Namen der Großeltern; eine Erklärung der Eltern war nötig. Später lernte er an der Uni ein Mädchen kennen, das ähnliche Erfahrungen gemacht hatte. „Das gab mir den Anstoß, mich zu ‚outen‘. Die Reaktion war positiv“, so der Journalist. Als er eines Tages seine jüdischen Wurzeln in einer Sendung erwähnte, fragte ihn ein Kollege entsetzt: „Hast du dabei auch an deinen Sohn gedacht?“ „Heute hätte ich mich, wahrscheinlich, nicht mehr auf diese Weise offenbart, denn der zunehmende Antisemitismus macht mir Sorgen. Und dennoch ist es in einigen Kreisen sehr im Trend, jüdisch zu sein“, lächelt Morosowski.
Geld verdienen mit dem „jüdischen Etikett“?
Ein typisches Beispiel dafür ist der Choreograf, Schauspieler und Fernsehmoderator Michal Pirog. Der berühmte Pole spricht mit Stolz über seine jüdischen Wurzeln. Nicht selten wird ihm sogar vorgeworfen, so auf sich aufmerksam machen zu wollen: Es sei förderlich für die Karriere. Diese Unterstellungen ignoriert Michal einfach. Auch macht er keinen Hehl aus seiner Homosexualität, und sieht hier Parallelen: „Je mehr Berühmtheiten sich als Homosexuelle outen, desto weniger Homophobie gibt es in der Gesellschaft. Wenn ein ‚jüdisches Etikett‘ das Toleranzniveau anhebt, bin ich dafür.“
Als Malka Kafka ihr jüdisches Restaurant eröffnet und später beim Fernsehen mit ihrer eigenen Kochsendung „Koscher-Macher“ angefangen hatte, wurde sie des Öfteren mit Aussagen konfrontiert, es sei fragwürdig, ja unanständig, mit dem „jüdischen Etikett“ Geld zu verdienen. „Interessant ist, dass solche Meinungen gerade in jüdischen Kreisen verbreitet sind“, räumt Malka ein. „Bedauerlicherweise sind viele Juden davon überzeugt: Die Vergangenheit muss schmerzen! Nein, ich verspüre kein Unbehagen, wenn ich darauf angesprochen werde.“ In der Tat, man könne es so sehen, dass sie aus ihrer Herkunft Kapital schlagen würde, aber wenn jemand in seinem Restaurant polské knedliky – Knödel – zubereitet, sollte das heißen, er würde seine polnischen Wurzeln „verkaufen“?
Diese Diskussion wird noch kontroverser, sobald es nicht nur um die jüdische Kultur geht, sondern auch um Erfahrungen aus dem Krieg. Agnes Yanich ist eine junge Künstlerin, die in New York und Warschau arbeitet; sie behauptet, die Erinnerungen an den Holocaust „im eigenen Körper“ zu tragen, daher vereint sie in ihrer Kunst das Kriegsthema mit Erotik. Agnes betont: Für sie sei das Judentum nicht nur die Frage der Wurzel, sondern auch die der Identität. „Seit mittlerweile sieben Jahren praktiziere ich das liberale Judentum“, erzählt Agnes Yanich. „Damit dieses Thema auch den Weg in meine Kunst findet, musste ich mich damit intensiv beschäftigen, es an mich heranlassen. Um mir den Kriegsalltag besser vorstellen zu können, ernährte ich mich ausschließlich von Kartoffel und Äpfeln und schlief nachts höchstens vier Stunden. Drei Jahre lang rasierte ich mir den Kopf kahl, trug nur Schwarz. Als ich die KZs besucht hatte, lief ich barfuß im Schnee.“ Sie sei es gewohnt, den Vorwürfen, sie „verdiene an dem Holocaust“, ausgesetzt zu sein, und sei nach wie vor empört darüber.
Die Vorfahren auf Bestellung
Die „Mode“, jüdisch zu sein, nimmt manches Mal auch merkwürdige Formen an. Immer häufiger kommen in das Jüdische Historische Institut (ZIH) Menschen, die keinerlei Gründe haben, sich als jüdisch zu begreifen, und bitten, nach ihren jüdischen Vorfahren zu suchen. „Dabei beziehen sie sich auf die Gewohnheiten im Alltag“, berichtet Anna Pschibyschewska-Drosd aus der genealogischen Abteilung des ZIH. „Sie erwähnen beispielsweise, dass es an den Samstagen zuhause besonders still wurde, oder dass die Oma das Milchige vom Fleischigen trennte. Dann muss ich erklären, dass das allein noch nicht ausschlaggebend wäre.“
Der Archivar kann einen Rat geben, wo man nachforschen könnte, um Informationen über die Großeltern zu finden, er kann auch prüfen, ob die Datenbank des Instituts bestimmte Namen enthält. Jedoch kann man sich keine Ahnen „anfertigen lassen“. Viele wollen das nicht akzeptieren, denn sie sehen im Jüdischsein das Mittel gegen Enttäuschungen und Scheitern. „Sie wollen sozusagen die Tür hinter sich zuknallen und stellen plötzlich fest, dass diese Tür nicht laut genug knallen kann. Sie sind empört, dass man ihnen den Traum wegnimmt“, fasst Anna zusammen.
Einige Geschichten sind vielmehr für einen Psychologen geeignet als für einen Archivar. Beim ZIH traf eines Tages ein Brief von jemandem ein, der sich als Holocaustüberlebender vorstellte. Er habe auf dem Dachboden ein Tagebuch gefunden, hieß es, es sei sein eigenes: Die Notizen stammen aus der Kriegszeit, als er sich verstecken musste. „Die Geschichte klang interessant, aber irgendetwas passte nicht zusammen. Vor allem war der Autor des Briefes viel zu jung, um selbst als Kind diese Zeit erlebt zu haben“, so Pschibyschewska-Drosd. Es stellte sich heraus, dass das Tagebuch von einer anderen Person verfasst wurde; der Autor des Briefes las es und war so beeindruckt und erschüttert, dass er sich mit diesem Menschen identifizierte und in der Tat glaubte, Jude zu sein und den Holocaust überlebt zu haben. „Jeder von uns möchte ein Geheimnis haben, ein Märchen erleben. Ein Versuch, seine unbekannten Vorfahren zu finden, deckt dieses Bedürfnis“, sagt Anna.
Akademikerrate und Madonna
Solche Menschen sehen in dem Wunsch, ein Jude zu sein, ein Mittel gegen den grauen Alltag; sie versprechen sich davon das Gefühl, zu einer Elite zu gehören. Laut der letzten Volkszählung sind 52,8 % der polnischen Juden Akademiker, 83,3 % besitzen mittlere Reife. Diese Zahlen sind wesentlich höher als beim Durchschnitt im Land. Malka Kafka ist der Meinung, dass diese „Schwärmerei“ der Polen für Juden eine Antwort auf die Sehnsucht nach geistiger Tiefe ist. Allerdings nach der Tiefe ohne schweres „religiöses Gepäck“. Agnes Yanich fügt hinzu, dass diese Sehnsucht auch das Streben nach Erfolg widerspiegelt: „Katholizismus und Protestantismus betonen Demut, das Judentum hingegen Selbstbewusstsein.“ Die Künstlerin betont, dass die jüdische Kultur und Philosophie im Westen sehr in Mode seien: „Es genügt, die Pop-Legende Madonna mit ihrem Interesse für Kabbala zu nennen!“
Dabei wirft eine solche Pop-Version des Philosemitismus Fragen auf. Zum Beispiel war Malka empört über die kleinen Figürchen der „Juden mit Pejes und Geld“, die auf einem jüdischen Festival verkauft wurden: „Für mich waren sie schlimmstes Fixieren auf Stereotype.“ Sie betont mit Nachdruck, dass die jüdische Kultur auf der ganzen Welt nicht ins Museum gehört, sie lebt. Ein Beispiel? Gerne: Der amerikanische Rapper Matisyahu, der seine Kippa unter der Baseball-Kappe trägt und chassidischen Reggae singt. Darüber, dass die jüdische Kultur eine lebendige ist, spricht auch Channa Paluba, Programmdirektorin der Stiftung „Schalom“: „Unser Ziel ist es zu zeigen, dass es sich um ein lebendes, sich entwickelndes Erbe handelt. Deshalb ist der Unterricht an der Jüdischen Offenen Universität nicht nur der Vergangenheit gewidmet, sondern beschäftigt sich auch mit dem heutigen politischen Geschehen. Jiddisch-Kurs, jüdische Küche, Singen- und Tanz-Workshops gewinnen stets an Popularität.“
Das nicht immer auserwählte Volk
Dennoch muss die israelische Soziologin Pauline Tschelnik betonen: „Diese Mode ändert leider nichts daran, dass der polnische Antisemitismus vorhanden ist. Es ist ein Trend, wie überall auf der Welt – das Interesse für Juden: Man lernt Kabbala, man hört Klezmer-Musik. Unklar ist mir aber, ob das tiefe Veränderungen der sozialen Mentalität sind, oder nur eine oberflächliche Tendenz.“ Vor Kurzem veröffentlichte Pauline Tschelnik das Buch „Das auserwähltes Volk“ – ihre umfassenden soziologischen Forschungsergebnisse über die Menschen in Polen, die nach vielen Jahren ihre jüdischen Wurzeln entdeckten. „Ich habe 40 Interviews geführt, und es waren lediglich zwei Menschen, die mir erlaubt haben, ihren richtigen Namen im Buch zu nennen. Das zeigt: Die Angst ist immer präsent. Die Wunde des Holocausts ist noch nicht geheilt. Bei ins in Israel ist es unvorstellbar!“ Und dennoch schätzt Tschelnik die Veränderungen in der polnischen Mentalität nach 1989 sehr: „Es freut mich, dass die Anzahl der Menschen, die offen ihr Jüdischsein deklarieren, wächst. Aber den Schätzungen zufolge leben in Polen in Wirklichkeit etwa 50.000 Juden. Das bedeutet, dass 85 % von ihnen ihre Herkunft verheimlichen – oder sie ist ihnen nicht bekannt. Wenn alles doch angeblich so gut sei – warum ist es dann so schlecht?“
Aus dem Russischen übersetzt von Irina Korotkina
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung