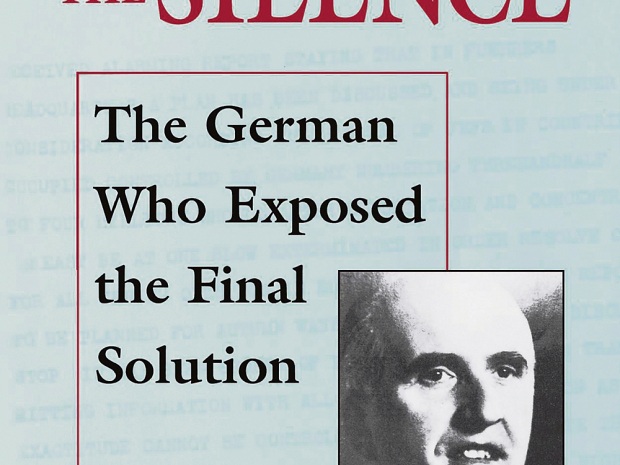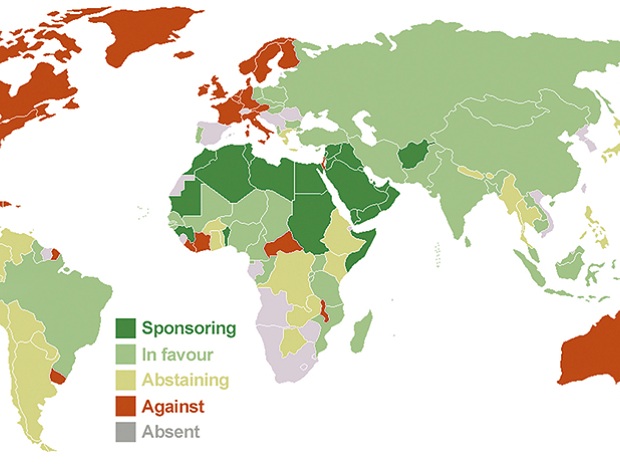Die heilige Hure
Zum 120. Geburtstag von Hedwig Porschütz: Die deutsche Prostituierte wurde bereits 2012 als „Gerechte unter den Völkern“ anerkannt, weil sie unter Lebensgefahr zahlreiche Juden während der NS-Zeit versteckte.

Gedenktafel an dem Haus, wo Hedwig Porschütz Juden versteckte. © WIKIPEDIA
Während des Zweiten Weltkrieges wurden Juden nicht nur von Menschen gerettet, deren Lebensweise den allgemein anerkannten sozialen und religiösen moralischen Standards entsprach, sondern auch von denjenigen, die von der Gesellschaft ausgestoßen wurden und als verabscheuenswert galten.
Hedwig Porschütz, geboren 1900, arbeitete als Stenographin in einer Fabrik, später in einem Versicherungsunternehmen. Sie heiratete. In den 1930er Jahren, der Zeit der Wirtschaftskrise, verlor ihr Mann seine Arbeit, und Hedwig begann, als Prostituierte ihr Geld zu verdienen. Über diese Zeit ihres Lebens ist wenig bekannt; es existieren lediglich Informationen darüber, dass sie 1934 für 10 Monate wegen Erpressung inhaftiert wurde.
1940 lernte Hedwig Porschütz Otto Weidt kennen, den Inhaber einer Blindenwerkstatt (Besen- und Bürstenbinderei), wo sie als Lagerverwalterin arbeitete. Als Berlin von Juden „gesäubert“ werden sollte, versteckte Weidt Juden; Porschütz half ihm dabei. Bis 1943 lebten in ihrer Berliner Wohnung jüdische Zwillingsschwestern; im März 1943 kamen noch zwei Jüdinnen hinzu: Greta Dinger mit ihrer Nichte. Dies gestaltete sich schwierig: Die Wohnung wurde stundenweise den Prostituierten-Kolleginnen überlassen, also musste man die Juden woanders verstecken, sobald ein Kunde auftauchte. Dafür zahlten Kunden nicht selten mit Lebensmittelmarken.
Im Sommer 1943 entdeckte die Gestapo im gleichen Haus ein jüdisches Paar, und Hedwig Porschütz war gezwungen, für „ihre“ Juden ein anderes, sicheres Versteck zu suchen. Eine Zeit lang wurden Greta Dinger mit ihrer Nichte im Hause von Hedwigs Mutter untergebracht.
Im Oktober 1944 wurde ein Bekannter von Hedwig verhaftet: Seine Lebensmittelmarken waren gefälscht. Man beschuldigte auch sie, sie habe „den Umgang mit Lebensmittelreserven manipuliert“. Sie wurde zu 18 Monaten im Arbeitslager Zillerthal-Erdmannsdorf (Riesengebirge) verurteilt. Die Tatsache, dass Hedwig die Marken selbst gefälscht hatte, blieb der Polizei offenbar verborgen.
Im Arbeitslager blieb Hedwig bis zum Kriegsende. Endlich draußen, erfuhr sie, dass ihr Haus zerbombt wurde. Hedwig und ihr Mann waren krank, es gab so gut wie keine Arbeit.
1956 beantragte Hedwig Sozialhilfe als Opfer nazistischer Verfolgungen. Beamte in Berlin waren der Ansicht, dass die Hilfe für Juden kein Akt des Widerstandes war. Außerdem lastete man Hedwig ihren Lebensstil an: Einer Prostituierten und Diebin (man bezog sich auf das damalige Nazi-Urteil) irgendwelche Privilegien zu gestatten, wäre doch anstandslos! Dementsprechend wurde ihr Antrag abgelehnt.
1959 wurden die Verdienste von Porschütz bei der Rettung der Juden von der „Stiftung der unerkannten Helden“ anerkannt, allerdings mit dem Vermerk, die heroische Leistung habe „unter der Bedingung der Demonstration eines derart niedrigen moralischen Niveaus“ stattgefunden, dass es völlig unmöglich sei, ihr die sozialen Privilegien von Widerstandshelden zuzuerkennen. Dabei bezogen sich die Berliner Beamten wieder einmal auf das Urteil des Nazi-Gerichts wie auch auf das Urteil von 1934, ohne Hedwig Porschütz oder die geretteten Juden als Zeugen anzuhören.
Richter machte weiter Karriere
Zu Lebzeiten erfuhr sie weder Anerkennung noch irgendeine Hilfe. Eine bittere Ironie des Schicksals war es, dass der Richter Joachim Weil, der 1944 das Urteil gefällt hatte, das in jeder Entscheidung über die abgelehnte Hilfe ausschlaggebend war, wieder seine berufliche Tätigkeit aufnahm und nie für seine Urteile belangt wurde – darunter auch zahlreiche Todesurteile. 1980 bemerkte er: „Mich trifft keine Schuld. Schwierige Zeiten, strenge Urteile.“
Hedwig Porschütz verstarb 1977 völlig unbekannt in einem Berliner Altenheim. Arno Lustiger, der berühmte Historiker des europäischen Judentums im 20. Jahrhundert, Autor von Büchern über die „Gerechten unter den Völkern“, übte 2005 in seiner Rede im Bundestag schärfste Kritik bezüglich der fehlenden Aufmerksamkeit rechtschaffenen Deutschen gegenüber. Er bemängelte die damals registrierte Zahl der Gerechten – 495 – als unzureichend und betonte, allein in Berlin seien es tausende Deutsche gewesen, die jüdischen Bürgern geholfen haben sollen. Er erwähnte in seiner Rede auch die Prostituierte Hedwig Porschütz, und nannte sie „die heilige Hedwig“. Die fehlende Erinnerung an sie als Heldin sei eine große Ungerechtigkeit.
Erst 2011 wurde das Urteil aus dem Jahr 1944 von der Staatsanwaltschaft Berlin aufgehoben.
2012 wurde an der Stelle des ehemaligen Hauses von Hedwig Porschütz eine Gedenktafel eingeweiht. Im gleichen Jahr wurde Hedwig Porschütz, zusammen mit ihrer Mutter, Hedwig Völker, als „Gerechte unter den Völkern“ anerkannt. In der entsprechenden Akte in Yad Washem ist der Eintrag recht kurz:
„Nationalität: Deutsch
Rettungshandlungen: Verstecken, Erstellung von Falschpapieren.
Beruf: Prostituierte“
Es gibt keine Fotos von Hedwig Porschütz und ihrer Mutter, nur die von den Geretteten.
Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden.
Aus dem Russischen von Irina Korotkina
Ein Blinder, der mit dem Herzen sah
Otto Weidt erlebte eine stürmische Jugend. Seine Familie kam aus Rostock nach Berlin, und dort verfiel er den Ideen der Anarchie und des Pazifismus, die in der Arbeiterjugend an Popularität gewannen. Während des Ersten Weltkrieges war er allerdings aus einem ernsteren Grund nicht an der Front – eine Ohreninfektion ersparte ihm den Krieg. Später begann er unglücklicherweise sein Augenlicht zu verlieren; seine Sehkraft verschlechterte sich rapide, bald wurde er blind und konnte lediglich mühsam die Konturen von Gegenständen erkennen. Ungeachtet dessen eröffnete er 1936 eine bescheidene Werkstatt – eine Besen- und Bürstenbinderei. Da er die Schwierigkeiten im Leben eines Invaliden aus eigener Erfahrung kannte, bemühte er sich, den Mitleidenden zu helfen und stellte meist Blinde und Taube an.
1940 erlangte Weidt für seine Werkstatt den Status „eines kriegswirtschaftlich wichtigen Unternehmens“ – auch bei der Armee brauchte man Besen und Bürsten.
Zu dieser Zeit stand für Otto Weidt bereits fest: Seine wichtigste Aufgabe wird sein, Juden zu retten. Seit den ersten Diskriminierungsmaßnahmen tat er alles, um Juden zu helfen. In seinem „kriegswichtigen Betrieb“ beschäftigte er nach und nach immer mehr Juden aus dem Jüdischen Heim für Blinde und rettete sie somit vor der Deportation. In den Jahren 1941-1943 waren von den insgesamt 33 blinden und tauben Beschäftigten der Werkstatt 30 Juden. Auch sehende Juden stellte Weidt, trotz strengen Verbots, an. Er bestach dafür einige Beamte mit Schmiergeldern.
Als die Gestapo zu den breitangelegten Festnahmen und Deportationen überging, begann die zweite Phase im Kampf des Otto Weidt. Er verkaufte einen Teil der Produktion seiner Werkstatt auf dem Schwarzmarkt, um genug Geld für die Bestechung der Offiziere zu erlangen. Darüber hinaus fälschte Weidt die Dokumente seiner jüdischen Angestellten und, wenn es nötig war, versteckte er sie im Hinterhof und sorgte dabei für ihr bescheidenes Wohl. Er kämpfte für jeden einzelnen Juden seiner Werkstatt. Als einige von ihnen dennoch inhaftiert wurden, konnte er in letzter Minute ihre Freilassung durchsetzen.
Im Februar 1943 bereitete die Gestapo die Deportation aller noch in Freiheit befindlichen Juden vor, die in der Kriegswirtschaft beschäftigt waren. Otto Weidt wurde rechtzeitig über die bevorstehende sogenannte „Fabrik-Aktion“ informiert und schloss seine Fabrik. Viele seiner Angestellten wurden jedoch deportiert. Weidt konnte 150 Pakete mit Lebensmitteln für Juden nach Theresienstadt schicken, später reiste er selbst dorthin, um so viele wie nur möglich aus dem Lager zu retten. Es ist ihm gelungen, einige Menschen – Blinde und Nicht-Blinde – in ein anderes Lager zu versetzen und somit zu retten. Die zukünftige Schriftstellerin Inge Deutschkron machte er zu seiner Sekretärin und später versteckte er sie zusammen mit ihrer Mutter bis zum Kriegsende in seiner Berliner Wohnung.
Nach dem Krieg eröffnete Otto Weidt ein Heim für jüdische Kinder, die die KZs überlebt hatten. Er selbst starb recht früh – 1947, mit 64 Jahren, an einem Herzanfall.

Am 7. September 1971 verlieh die Gedenkstätte Yad Washem an Otto Weidt den Titel „Gerechter unter den Völkern“. 1993 befestigte Inge Deutschkron eine Gedenktafel an der Wand der ehemaligen Werkstatt; seit 2005 befindet sich dort das Museum „Blindenwerkstatt Otto Weidt“.
Aus dem Russischen von Irina Korotkina
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung