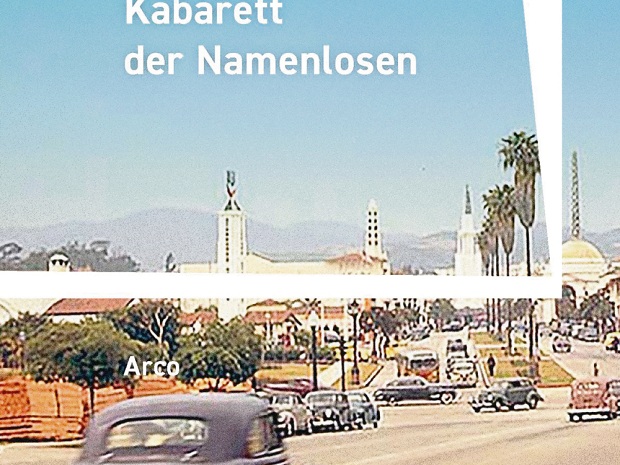Für meine schoah-überlebenden Eltern war die Verwendung der deutschen Sprache noch lange ein Tabu!
Der israelische Komponist Yuval Shaked über seine Zeit in Deutschland - mit dem Original-Koffer der Tante aus Auschwitz zum Studium nach Köln

Der Komponist Yuval Shaked
Wir hatten uns in Cäsarea verabredet, Yuval Shaked wollte mich vom Bahnhof Pardes Hanna abholen und mit uns zu den archäologischen Stätten fahren, die zum Nationalpark erklärt wurden. Ich freute mich auf die Begegnung mit ihm, den ich bisher nur von seinen Briefen her kannte. Außerdem war ich noch nie in Cäsarea, wo vor zweitausend Jahren Herodes einen Hafen gebaut hatte. Kurz nach sieben Uhr erreichte mich die Nachricht von Yuval, dass sämtlicher Bahnverkehr durch einen Streik lahmgelegt worden sei. Ein unangekündigter Streik! Wenn ich nicht zu ihm fahren könne, würde er eben zu mir mit dem Auto nach Tel Aviv kommen.
Schließlich treffen wir uns am Nachmittag in einem russischen Restaurant an der vielbefahrenen Ben Yehuda Street, die parallel zur Küste verläuft. Wir begrüßen uns mit einer Umarmung, obwohl wir uns zum ersten Mal sehen, und ohne uns darüber zu verständigen, sind wir sofort beim Du.
Der ebenso agile wie aufgeschlossene Mann mir gegenüber mit der blaugeränderten Brille und dem Gelassenheit ausstrahlenden Brillenband, der Soljanka löffelt wie ich, ist einer der herausragendsten Komponisten Israels.
Paris, Köln oder Frankfurt?
Er hat Musik zunächst in Tel Aviv studiert. Aber Israel war 1981 tiefste Provinz, man musste ins Ausland, um auf dem neuesten Stand zu sein. Die meisten seiner Mitstudenten gingen nach Amerika. Aber er nimmt prinzipiell nie den Weg, den viele andere wählen. Eine sympathische Haltung, die vielleicht nicht immer die einfachste ist! Für ihn gab es drei Optionen: einmal Paris, um sich dort mit elektronischer Musik zu beschäftigen, mit musique concrète, zum anderen Frankfurt oder Köln. Köln war durch den WDR das Zentrum für Neue Musik in Europa, außerdem lehrte der damals schon legendäre Mauricio Kagel an der Musikhochschule, den Yuval Shaked bereits vom Festival für Neue Musik in Israel kannte, das eine aus Deutschland stammende Jüdin ins Leben gerufen hatte und es leider heute nicht mehr gibt.
Recha Freier, eine Dichterin, die in den 1930er Jahren in Berlin lebte und mehr als siebentausend jüdischen Jugendlichen das Leben rettete, indem sie ihnen nicht immer legal Ein- und Ausreisepapiere beschaffte. 1940 wurde sie denunziert, ihr aber gelang die Flucht ins britische Mandatsgebiet. Yuval entschied sich für Köln, Mauricio Kagel wurde sein Lehrer.
Yuval wurde 1955 im 25 Kilometer südlich von Tel Aviv entfernten Kibbuz Gezer geboren, der damals an der Grünen Linie, an der Grenze zwischen Israel und Jordanien, lag. Er hat noch heute lebhafte Erinnerungen an den Sechstagekrieg, an furchterregende Bomber, die über ihn hinwegdonnerten, als er auf dem Weg zur Schule war, an nachts verdunkelte Häuser.
Ein deutsches Auto
Kurz vor dem Krieg wurde Familienrat abgehalten. Es ging darum, sich ein Auto anzuschaffen, wobei der stimmberechtigte zwölfjährige Yuval für ein deutsches Auto plädierte. Nach langem Hin und Her schaffte sich die Familie einen NSU Prinz 1000 an. Natürlich war es ein Problem, in Israel ein deutsches Auto zu fahren: Man schrieb das Jahr 1967. Sieben Jahre davor wurden überhaupt erst diplomatische Beziehungen aufgenommen, dann kamen die Wiedergutmachungszahlungen, der Handel zwischen den Ländern begann Mitte der 60er Jahre. Das neuerworbene Auto wurde allerdings schon bald darauf vom Militär für den Krieg requiriert, weil man dringend Transportmittel benötigte. Es kam zur großen Erleichterung der Familie funktionstüchtig zurück.
„Mein Vater stammt aus Wien, seine Eltern haben ihn und den Bruder kurz vor dem Anschluss 1938 hinausgeschickt“, erzählt Yuval. Er ging nach Schweden, kam in ein Dorf in der Nähe von Stockholm, wo jüdische Jugendliche eine landwirtschaftliche Ausbildung erhielten, um später in den Kibbuzim arbeiten zu können. Er hieß Siegfried, änderte den Namen, weil er entgegen seiner Ausbildung Schuldirektor wurde, er nannte sich fortan Schlomo. Yuvals Mutter Judith, die aus der Nähe von Brünn stammt, hieß ursprünglich Zdenka Stiasna. In der Familie wurde unter den Erwachsenen Deutsch gesprochen, etwa wenn die Eltern sich stritten, damit die Kinder nicht verstehen, was sie nicht verstehen sollten. Aber die deutsche Sprache war tabu wie die deutsche Kultur. Natürlich war der NSU Prinz 1000 auch ein Tabubruch wie Yuvals Studium in Köln.
Kibbuz-Kommunismus
Als er zurück nach Israel kam, lernte er seine zweite Frau kennen, die in einem Kibbuz im Norden lebte. Er hatte vergessen, was Kibbuzim waren, die damals noch vom sozialistischen Gedanken geprägt wurden. Im Speisesaal diskutierten die Mitglieder, ob man sich privat einen Whirlpool zulegen darf oder nicht. Luxus war verpönt, alle Kibbuz-Mitglieder hatten gleich viel zu verdienen nach dem Motto: Jeder leistet so viel er kann, und er bekommt so viel, wie er braucht. Diese Maxime entsprach in etwa dem, was in der DDR theoretisch unter Kommunismus zu verstehen war, aber nie praktiziert werden konnte. In Israel, in den Kibbuzim indessen schien es gelebte Realität gewesen zu sein. Als sein Vater von einem Verwandten aus den USA ein Transistorradio geschenkt bekam, wurde es im Speisesaal aufgestellt. Warum sollte einer allein ein Radio besitzen dürfen? Es hat allen zu gehören.
Die Philharmonie in den Anfangsjahren
Das Kulturleben Israels wurde zum großen Teil von den Einwanderern aus Mitteleuropa gestaltet, die es so haben wollten, wie sie es kannten. Sie gründeten 1936 die Israelische Philharmonie, die damals noch „Palästinensisches Symphonisches Orchester“ hieß. Die Interessenten warteten geduldig, bis jemand ausschied, um das Abonnement kaufen zu können. In den 70ern kam Leonard Bernstein in jedem Jahr nach Israel und brachte immer eine andere Mahler-Symphonie mit. Herma Alina, die angeheiratete Tante seiner Mutter, hatte ein Abonnement für die Philharmonie, sie ging zu jedem Konzert mit ihrer Freundin, mit Frau Semmel. „Frau Semmel und Frau Alina!“, sagt Yuval lächelnd mit selbstironischem Ton: „Frau Semmel wusste von den Nazis, dass die Musik von Mahler banal ist und auch noch entartet. Ich verdanke meine musikalische Erziehung Frau Semmel und den Nazis, ohne Frau Semmel hätte ich Mahler nicht kennengelernt.“ Die Philharmonie spielte das gleiche Programm zwölfmal im Jahr vor jeweils 3.000 Abonnenten. Die Philharmonie fuhr zudem nach Haifa und Jerusalem. Heute dagegen spielt das Orchester das gleiche Programm höchstens dreimal und vor nicht ausverkauftem Haus. Es hat sich vieles seit den Anfangsjahren verändert. Einmal starben die Gründungsväter aus, zum anderen passiert das gleiche wie in Europa: Die Anzahl der Konzertbesucher geht zurück. Die gegenwärtige Situation stellt sich ihm ernüchternd dar: „Das Programm der Philharmonie ist sehr traditionell. Es gibt keine Neue Musik, die andere wird schlecht gespielt. Die Programme entbehren jeglicher Konzeption.“
Viele arabische Studenten
Yuval ist zwar Komponist, aber auch Professor für Musik an der Universität in Haifa. 60 bis 70 % seiner Studenten sind Araber: Christen, Muslime, Drusen, manchmal Tscherkessen, die Anzahl der Muslime steigt, die der Christen sinkt, weil sie in großen Zahlen auswandern. Die Mönche und Nonnen geben seit den 1930er Jahren den Arabern professionell Klavierunterricht. Im Moment komponiert Yuval ein Orchesterstück für den ORF und für das Radio in Israel, was eher die Ausnahme ist. Er komponiert am häufigsten Kammermusik, auch Musiktheater und schreibt Musik für Hörspiele. Der Komponist kann nicht leben, ohne gleichzeitig Hochschullehrer zu sein. „Freischaffende Komponisten sind vielleicht freischaffend, aber frei sind sie nicht. Man müsste ständig mindestens drei Aufträge bekommen, was nicht möglich ist“, stellt er desillusionierend fest und nimmt einen kräftigen Schluck Wasser. Ich habe mir Bier bestellt, leider schenkt man hier nicht das einheimische „Goldstar“ aus, es gibt Tuborg. Als ich bestimmt erkläre, dass ich nachher bezahlen werde, er mein Gast sei, schließlich sei er meinetwegen extra nach Tel Aviv gefahren, nickt er vielsagend, um sogleich weiter zu erzählen. „Aber es tut sich etwas, in den 80er Jahren wurde ein Sender für Ernste Musik gegründet, immerhin! Es gibt ein Rundfunkorchester, das lediglich spielt, der Sender vergibt keine Aufträge. Er schneidet bei Veranstaltungen mit, produziert aber nicht selbst.“
Yuvals Stücke werden mehr in Deutschland gespielt als in Israel, worüber er glücklich ist. Ich staune nicht schlecht, aber der Grund leuchtet schnell ein: In Deutschland spielen phantastische Musiker seine Stücke, deshalb hat er nicht den Drang, in Israel zu arbeiten. Hierzulande wird vor dem Auftritt viel weniger geprobt. Die Philharmonie würde nie ein Stück von ihm spielen, aber wenn, dann würde er so wenige Proben bekommen, dass es keinen Sinn macht. Die Philharmonie wird vom Staat subventioniert unter der Bedingung, dass pro Jahr ein Stück eines israelischen Komponisten gespielt wird. Ansonsten sucht sie sich populäre Musikstücke aus. Man spielt das, was die Abonnenten mögen; wenn sie etwas nicht mögen, klatschen sie nicht, unter Umständen erneuern sie sogar das Abonnement nicht – es kommen also sofort wirtschaftliche Aspekte zum Tragen. In allen Bereichen setzt sich das marktwirtschaftliche Denken durch.
Yuval lebte nach seinem Studium wieder mehrere Monate in Deutschland, hatte ein Aufenthaltsstipendium, ist oft zu Tagungen dort, eben war er in Darmstadt, demnächst wird er in Weimar sein. An die Übersiedlung nach Deutschland hat er dennoch nicht gedacht. Die Situation ist komplex, er würde gern eine längere Zeit im Ausland leben und arbeiten, aber er hat vier Kinder, drei Enkelkinder und noch seine 94-jährige Mutter. Er liebt Israel, obwohl ihm das Land das Leben schwer macht. „Wenn es jemals eine Generation gegeben hat, die gewusst hätte, wie man es hätte besser machen können – dann war es die Generation meiner Eltern. Sie hätte es damals wissen müssen, damit dass Land nicht kaputtgehen kann.“
Innerisraelische Spannungen
Er hält die Politik der letzten Jahre für verhängnisvoll, nicht, dass alles falsch gewesen wäre, das gewiss nicht, aber die Stimmung im Land ist schlecht. Die Auffassung der Regierung von Demokratie, der schmutzige Wahlkampf, die Ignoranz gegenüber den „Palästinensern“ – das alles ist ihm kritikwürdig. Israel ist so stark, dass man großzügiger mit seinen Nachbarn umgehen sollte. Viele Israelis verlassen das Land auch weil der Wohlstand reizt, vor allem jedoch, weil sie ein ruhigeres Leben suchen. Er sagt: „Die Raketen aus Gaza sind eine Bedrohung, aber gefährlicher ist die innerisraelische Spannung, die das Land zu zerreißen droht.“
Yuvals Eltern meinten, die Beschäftigung mit Musik könne doch kein Beruf sein, aber sie versuchten nicht, ihn umzustimmen, im Gegenteil, sie unterstützten ihn, auch als er im Sommer 1981 einen Koffer brauchte. Heute würde man einfach einen kaufen, doch damals wurde, wenn es sich als sinnvoll erwies, von der Substanz gelebt. Seine Mutter riet ihm, Tante Herma Alina aufzusuchen, die zu diesem Zeitpunkt schon bettlägerig war. Sie sagte: Geh doch in die Kammer neben der Küche, da gibt es einen Koffer. Er war in einer selbstgenähten Stoffhülle eingepackt, damit er nicht verstaubt. Zu Hause ließ sich seine Mutter den Koffer zeigen und wurde blass, auf dem Deckel stand mit weißer Schablonenschrift: HANDWERKSZEUG. Die Geschichte des Koffers ist die Geschichte der Familie, die in Prag lebte und eine Fabrik für Füllfederhalter betrieb – eine Geschichte, die unbedingt erzählt werden muss, bevor sie in Vergessenheit gerät.
Es war der Koffer des Sohnes von Herma Alina, den er 1943 mit nach Theresienstadt nehmen konnte, wohin ebenso Vater und Mutter deportiert wurden. Herma Alina kam mit diesem Koffer anschließend nach Auschwitz-Birkenau. Sie überlebte die Hölle und nahm ihn mit nach Israel, den sie all die Jahre aufgehoben hat, und überlässt ihn dem Neffen, als er nach Deutschland aufbricht, um dort zu studieren. Ihr Ehemann und ihr Sohn wurden nach Dachau deportiert und dort ermordet. Sie hat in Israel noch einmal geheiratet. Von den Verwandten ihres neuen Mannes haben die meisten nicht überlebt, sie kamen in Theresienstadt oder Ausschwitz um. „Eine typisch israelisch-jüdische Geschichte“, stellt Yuval nüchtern fest und gießt sich Wasser nach. „Das Verhältnis zu Deutschland hat sich indes massiv verändert. Das historisch belastete Thema kommt nicht einmal mehr in den Gesprächen auf.“
Als ich die Kellnerin heranwinke, stolz auf mein Schulrussisch, zeigt sie sich nicht im Geringsten beeindruckt, sondern wendet sich Yuval zu, der souverän die Rechnung fordert. „Aber das nächste Mal, in Deutschland bezahle ich. Besser ist es, du kommst mich besuchen.“
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung