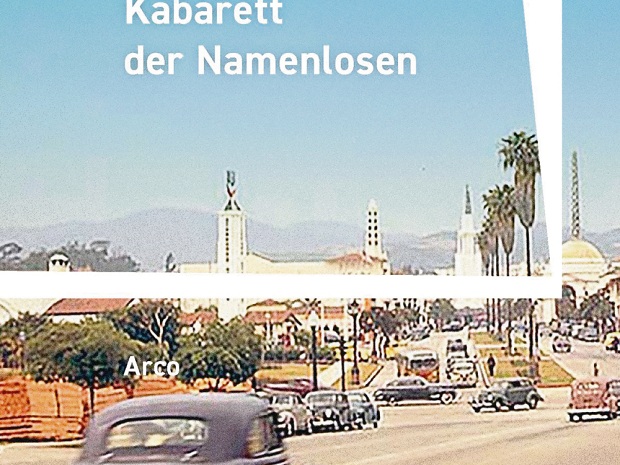Die bunte Vielfalt der Juden Österreich-Ungarns
Rezension des ersten Buches des „MENA Watch“-Gründers Erwin Javor

1947 in Budapest geboren, entfloh die Familie Javor drei Jahre später dem kommunistischen Regime Ungarns, um sich in Wien niederzulassen. Dabei verstand man sich von Anfang an als reine Durchreisende, auch wenn das Ziel unbestimmt war: Israel vielleicht? Oder gar die USA? Australien – das wäre schon sehr weit weg! Mehr als einhunderttausend Juden aus Ungarn, Polen, der Tschechoslowakei oder Rumänien landeten so in den Nachkriegsjahren in der Hauptstadt der Zweiten Republik. Aber selbst, wenn sie blieben: Nicht nur für sie, auch für die nachfolgenden Generationen war eine Verwurzelung keineswegs selbstverständlich – „man lebte im beständigen Gefühl, sicherheitshalber besser stets einen Koffer gepackt zu haben“.
Dabei hatte sich zumindest Erwin Javor mittlerweile, legt man die Fakten zugrunde, durchaus in Österreich etabliert. 1969, erst 22-jährig, erwarb er die Firma Frankstahl, heute mit Sitz in Traiskirchen (und bekannt als landesweite „Anlaufstelle für Flüchtlinge aus aller Welt“, gelegen im Bezirk Baden, Niederösterreich, etwa 20 Kilometer südlich von Wien), 1880 von jüdischen Unternehmern in Wien gegründet, während des Dritten Reiches „arisiert“ und erst über 20 Jahre nach Kriegsende an die ursprünglichen Besitzer retourniert worden. Im Jahre 2000 gründete Javor das jüdische Magazin für Politik und Kultur namens „Nu“, elf Jahre später die Medienbeobachtungsstelle Naher Osten (MENA-Watch, der unabhängige „Nahost-Thinktank“, vgl. die JR, Ausgabe 12/2015), welche sich zum Ziel gesetzt hat, zur Verbesserung der Qualität der Berichterstattung über den Nahen Osten im Allgemeinen und Israel im Besonderen beizutragen. Schließlich brachte er im Frühjahr 2014 die „Brauer-Haggada“ heraus, für das der Maler (und Sänger) Arik Brauer 24 Illustrationen schuf – mit Kommentaren zum Originaltext von Paul Chaim Eisenberg (1983-2016 der Oberrabbiner Wiens), oder Joshua Sobol, 1939 in Palästina geboren als Sohn osteuropäischer Einwanderer.
Trotz des Eingebundenseins in Österreich, dem Land, in dem er praktisch sein ganzes Leben verbrachte, will Javor die Erinnerung an die untergegangene Welt der Ostjuden, soweit er sie noch selbst in sich trägt, irgendwie am Leben erhalten. Grund genug, dies alles in einem Werk zusammenzufassen. Dabei nimmt der „jüdische Witz“ eine zentrale Stellung ein: Das Buch ist davon zu Dutzenden gespickt, darunter einige wenige, die der Schreiber dieser Zeilen selbst noch nie gehört hatte, andere, die er interessanterweise aus einem nicht-jüdischen Umfeld kennt. Dem jüdischen Witz geht es neben Widerstand gegen Antisemitismus und Verfolgung insbesondere „gegen alle anderen übermächtigen Gegner und Umstände des Lebens“. Typische Facetten dieses Humors seien Selbstironie, aber auch Selbstzweifel, Selbstkritik und kreative Lösungen. So beschreibt er beispielsweise – und wie immer ist in jedem Witz mindestens ein Körnchen Wahrheit enthalten – die Mischpoche, die jüdische Familie wie folgt: Sie „besteht aus ihrem Zentrum, der Mamme, dem – wie man auch an mir [= E. Javor] sieht – eher unauffälligen Ehemann des Zentrums und den Kindern, welche ausnahmslos Genies sind“. Jüdischer Humor hin und her: Es müsste kaum noch hinzugefügt werden, dass hinter jeder guten Pointe wie bei jeder guten Komödie eine Tragödie steht. Wenngleich jüdische Eloquenz vor allem davon lebt, mit möglichst wenigen Worten möglichst viel zu sagen.
Schtetl-Juden, Stadt-Juden, ungarische und polnische Juden
Javor beschreibt die jüdische Welt, wie er sie im Mikrokosmos der Stadt Wien in den Nachkriegsjahren erlebte: Die Gestrandeten eben, die je nach Herkunft weiterhin unter sich weilten; die Stadt-Schtetl-Hierarchie, wie sie in den Herkunftsländern herrschte, blieb eben auch am Zufluchtsort erhalten. Außerdem gab es nach wie vor die inoffiziellen Hierarchien von Landsmannschaften: Ungarische Juden wurden verachtet, weil sie als assimiliert galten. Polnische Juden aus Warschau sprachen polnisch, der Rest jiddisch. Die rumänischen befanden sich am Ende der Messlatte, ebenso wie die alteingesessenen assimilierten Wiener Juden – soweit es sie überhaupt noch gab – auf die Gesamtheit der Ostjuden herabschaute.
Trotzdem gab es verblüffende Gemeinsamkeiten, indem sich das „Gemisch an Landsmannschaften mit ihren komplexen Hackordnungen, Eifersüchteleien und Hochstapeleien trotz zelebrierter Unterschiede und sorgsam gepflegter Innenmauern gleichzeitig als eine homogene Gruppe“ gestaltete. Stolz war man auf alles, was irgendwie einen jüdischen Ursprung hatte. Die Ostjuden etwa feierten konsequent Chanukka und niemals Weihnachten – das wäre eine Schande gewesen. Die alteingesessenen Wiener Juden [wir wissen ja von Theodor Herzl und seinem Weihnachtsbaum] nahmen es da weniger genau, indem man sich in den von Juden frequentierten Gasthäusern „teilweise widerwillig, teilweise mit höchstem Genuss – oder beidem“ lokalem Kulturgut hingab. In jedem Fall aber waren alle stolz auf die von Juden komponierten Weihnachtslieder wie „Let It Snow“ oder „White Christmas“, selbst wenn die Komponisten in den USA längst ihre (ost-) jüdischen Namen abgelegt hatten. Sonst verbrachte man viele Sonntagnachmittage „am Cobenzl“ – ein lokaler Austriazismus, mit dem man „draußen“, d.h. in Deutschland, sicherlich nichts anfangen kann. Hierbei handelt es sich um eine als beliebtes Ausflugsziel bekannte Anhöhe am Rande Wiens mit Schloss und Weingut. Die Sonntagvormittage verweilte man eher im Café Schwarzenberg in der Ringstraße, ab 1945 zum sowjetischen Sektor gehörig, in dem ein bestimmter Teil für Ostjuden reserviert war; hier tauschte man Erinnerungen aus der alten Heimat aus, sprach über Geschäfte, diskutierte und stritt sich – wie überall – über meist belanglose Angelegenheiten.
Christen müssen fürs Paradies weniger leisten
Jedoch letztlich: Für wen ist nun dieses Buch gedacht? Immerhin das beste (da einzige), dass Javor bislang geschrieben hat? Auch darüber hat der Autor intensiv sinniert: Nämlich vor allem für „Nicht-Juden, die sich für die jüdische Kultur interessieren und wenig Gelegenheit haben, Juden kennenzulernen“. Ein „mulmiges Gefühl“ bekomme er allerdings, wenn er an die möglichen Reaktionen jüdischer Leser denke: „Zuerst werden sie behaupten, sie kennen viel bessere Witze, Anekdoten und Typen. (…) Dann werden sie mir erklären, was ich alles falsch erzählt habe“. Das mag in vielen Fällen treffend sein, wie der Schreiber dieser Zeilen aus eigener Erfahrung kennt. Um jedoch zu erfahren, zu welcher Kategorie Mensch der potentielle Leser gehöre, müsse er (oder sie) das Buch in erster Linie allerdings selbst lesen. Dass an mehr als nur einer Stelle zumindest ein Schmunzeln nicht unterdrückt werden kann, sei hiermit garantiert! Übrigens: Dem nicht-jüdischen Leser, eigentlich allen Nichtjuden, rät Javor eindringlich ab, zum Judentum überzutreten. Glaube man nämlich an das Paradies, hätten es die Nichtjuden doch wesentlich leichter, darin Eingang zu finden, da diese zumindest gemäß der Halacha wesentlich weniger Regeln und Gesetze einzuhalten hätten, zumindest keine 623. Das sollte nun wirklich einen Gedanken wert sein… Ein relativ umfangreiches Glossar erklärt abschließend die zahlreichen jiddischen, teils hebräischen oder auch austro-bajuwarischen Ausdrücke, ohne die ein Buch über Ostjuden – geschrieben für alle – nicht auskommen kann.
Erwin Javor
Ich bin ein Zebra – Eine jüdische Odyssee
Wien 2017 (249 S., Amalthea Verlag, € 25,00)
ISBN 978-3-99050-092-7
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung