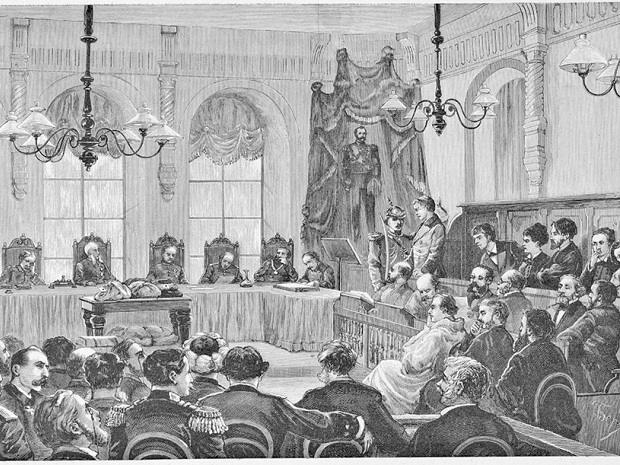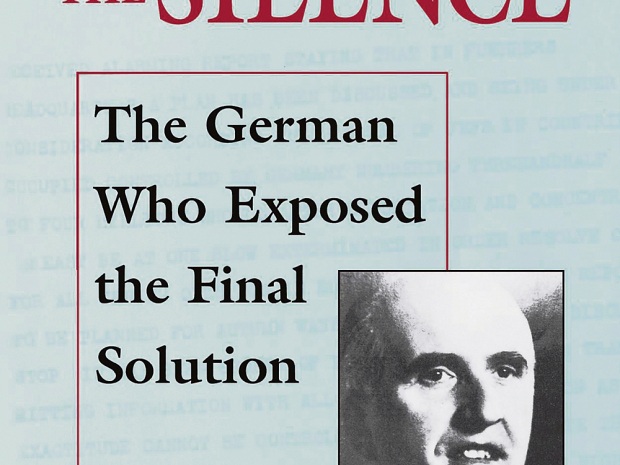Streben nach Selbstbehauptungund Anerkennung
Jüdischer Sport in Deutschland 1919 bis 1938

Die Historiografie der deutsch-jüdischen Geschichte hat in den letzten Jahren, anders als die Forschungen auf geistesgeschichtlichem Gebiet, dem Thema „Jüdischer Sport“ in Deutschland zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt, dennoch gibt es diesbezüglich immer Neues zu entdecken.
Das gilt vor allem für Forschungen im regionalen Raum. Auch wenn lokale Studien vorliegen, mangelt es bislang an Forschungen, die auch den alltags- und sozialgeschichtlichen Aspekt in den Blick nehmen, die z. B. jüdische Tageszeitungen und die jeweiligen Synagogenblätter als zentrale Quellen thematisch auswerten.
Große Verdienste auf dem Forschungsfeld der deutsch-jüdischen Sportgeschichte hat sich der Hannoveraner Sportwissenschaftler Lorenz Peiffer erworben, der in dem vorliegenden Handbuch mit dem Co-Autor Arthur Heinrich, ein ausgewiesener Kenner auf dem Gebiet des jüdischen Fußballsports, ein beeindruckendes Werk über Juden im Sport in Deutschland in den so gegensätzlichen Epochen zwischen 1919 und 1938 mit dem regionalen Schwerpunkt Rheinland und Westfalen, beginnend mit Aachen, endend mit Wuppertal, vorgelegt hat.
Sportwissenschaftler als Buchautoren
Damit haben die beiden Sportwissenschaftler eine Leerstelle geschlossen. Ein Standardwerk.
Wer sich für jüdischen Sport interessiert, wer wissen will, was sich in den genannten Jahren im jüdischen Sport in Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln oder Oberhausen, oder wie auch immer auch kleineren Orte wie Niederbarsberg, Hochneukirch-Jüchen heißen, abgespielt hat, wird hier fündig. Der Leser erhält Auskunft in den Rahmendaten einzelner Vereine: Gründung, Auflösung, Mitgliedschaften in einem der verschiedenen jüdischen Sportverbände, wie z. B. im Jüdischen Ping-Pong-Club in Köln aus dem Jahr 1929. Eine archivalische Kärrnerarbeit, auch wenn man in dem Handbuch ein Register vermisst.
Jüdischer Sport hat eine lange, spezifische Geschichte, die gekennzeichnet ist durch Zurücksetzungen und Ausgrenzung. In der von „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn „vaterländisch“ geprägten deutschen Turnbewegung, an der es an völkischen und antisemitischen Tönen nicht gemangelt hat, war wenig Platz für Juden. Ein „Arierparagraph“ schloss Juden von der Mitgliedschaft in deutschen Sport-Vereinen aus. Bei Jahn war alles, was er als „undeutsch“ wahrnahm, verwerflich: „Hass alles Fremden ist des Deutschen Pflicht“, polemisierte er gegen „Völkermischung“. Es gibt Aussagen, in denen dieser unter anderem vom „jüdelnden Weltbürgertum“ spricht oder davon, dass „die Welt durchjudet und durchnegert“ werde. Sollten Juden in einer solchen Bewegung, in der solche Ansichten propagiert wurden, mitturnen?
Muskeljuden
Auf dem 5. Zionisten-Kongress 1901, rief Max Nordau, der Ideologe des „Muskeljudentums“, die Juden auf, ihr Interesse am Sport und an der körperlichen Ertüchtigung zu erneuern. Die Ausübung von Sport bedeutete den Juden, denen lange die Mitgliedschaft in der deutschen Turnbewegung verwehrt war, neben der Entwicklung zu einem neuen, körperlichen Selbstbewusstsein auch ein Beitrag zur Abwehr des Antisemitismus. Jüdischer Sport war der Versuch, das weitverbreitete Vorurteil von der körperlichen Minderwertigkeit der Juden zu widerlegen, aber nicht zuletzt auch, um gesellschaftliche Anerkennung zu finden.
Doch Nordaus Forderung ging weiter: Körperliche Betätigung sollte zugleich Mittel gegen die „Degeneration der Nation“ und für die Rückkehr zur jüdischen Selbstachtung und damit zum Wiederaufbau einer jüdischen Nation sein.
Der moderne Antisemitismus hat die angebliche körperliche Schwäche als negatives Merkmal des Judentums immer wieder hervorgehoben. Dem wollte der „moderne“ Zionismus ein ideologisches Argument entgegenhalten: Die nationaljüdische Bewegung wollte den „neuen Juden“ erfinden, um ihren Gegnern ein Gegenbild zum antisemitischen Image anzubieten. Angesichts eines real-existierenden Antisemitismus lagen für Nordau die Gründe für jüdisches Turnen und Sport auf der Hand: „Der Welt ist immer noch die Ghettogestalt des geduckten Jüdchens geläufig, die ihren Hohn und ihre Verachtung erregt. Wir müssen uns aus der Karikatur herausarbeiten und uns … erheben“. Der Diasporajude sollte durch den stolzen, physisch anmutenden Juden ersetzt werden, so das zionistische Leitbild.
Die Makkabi-Vereine und „Selbstgleichschaltung“
Die Antwort darauf war die Makkabäer-Bewegung, die über Europa und Palästina und dann um die ganze Welt ging. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges gab es in Europa über 100 Makkabi-Vereine. Die größten – Ha-Koah in Wien, Bar Kochba in Berlin und Ha-Gibor in Prag – waren berühmt für ihre hervorragenden Mannschaften. Bar Kochba Berlin wurde 1898 der erste jüdische Turnverein auf deutschem Boden. Bis zum Jahre 1914 entstanden auch in einer Reihe weiterer Städte innerhalb und außerhalb des Reichsgebietes derartige Vereine. Sie schlossen sich in der „Jüdischen Turnerschaft“ zusammen, die 1921 im zionistisch ausgerichteten „Makkabi-Weltverband“ aufging. Stark waren die im „Reichsbund jüdischer Frontsoldaten“ befindlichen Gruppen, die in mehr als 100 Vereinen zusammengeschlossen waren.
Während für Juden im 19. Jahrhundert das Turnen populär war, zog es ihre Söhne danach zu anderen Sportarten, vor allem in die Fußballklubs. Fußball im Nationalsozialismus war keine politikfreie Insel der Sport-Seligkeit. Im Gegenteil: Der Prozess der aktiven Beteiligung von Vereinen und Verbänden an der nationalsozialistischen „Revolution“ begann bereits in den ersten Wochen und Monaten nach dem 30. Januar 1933. In vorauseilendem Gehorsam, eilfertig und eigenmächtig, führten deutsche Turn- und Sportvereine das „Führerprinzip“ ein und bekannten sich offen zu den sattsam bekannten Zielen der braunen Machthaber. Diese gefügige Kooperation, die man auch Kollaboration nennen mag, verdient eher den Namen einer „Selbstgleichschaltung“.
Bereits im April 1933 wurden die jüdischen Mitglieder aus dem Deutschen Fußball-Bund ausgeschlossen. Einige Vereine bekannte sich uneingeschränkt zum „Arierparagraphen“ und verfassten eine Resolution, in der sie bekundeten, sich „der nationalen Regierung [...] freudig und entschieden“ zur Verfügung zu stellen und ihre Mitarbeit „insbesondere in der Frage der Entfernung der Juden aus den Sportvereinen“ anboten.
Zionisten und Assimilatoren
Deutsch-jüdische Sportler trieben vor 1933 ihren Sport nicht als Juden. Im Gegensatz zu den konfessionellen Sportorganisationen und der Arbeitersportbewegung wurden die jüdischen Sportverbände 1933 in Deutschland zunächst nicht aufgelöst. Jüdische Sportverbände nahmen vielmehr in den folgenden Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung, weil er den aus Vereinen des „Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen“ ausgeschlossenen Juden eine letzte Möglichkeit sportlicher Betätigung bot. Sowohl „Makkabi“ (zionistisch) wie auch „Schild“ (assimilatorisch) erlebten nachgerade einen Mitgliederansturm. Es klingt merkwürdig: Sport wurde zu einer der wichtigsten Bastionen der Selbstbehauptung, mit der sich Juden in ihrem Alltag gegen die Herrschaftsprinzipien des Nationalsozialismus zur Wehr setzten. Man mag es eine Form des Widerstands nennen. Neben der Synagoge als Zentrum des religiösen Lebens wurde der Sportplatz, die Turnhalle, er Tischtennisraum oder der Boxring zu einem zweiten Zentrum in den jüdischen Gemeinden.
Die Nationalsozialisten ließen nach der Inmachtsetzung Hitlers, verfangen in ihrem Rassenwahn, nicht viel Zeit verstreichen, um die jüdischen Sportler aus den allgemeinen, paritätischen Sportvereinen zu entfernen. Um sich auch weiterhin sportlich betätigen zu können, sahen sich Juden gezwungen, eigene – jüdische – Sportvereine zu gründen. Das galt namentlich für jüdische Fußballspieler. Jüdische Fußballvereine bauten ihre eigenen Vereinsstrukturen auf, Vereine, in denen sie zunächst unbehelligt ihrem geliebten Sport nachgehen konnten. So entstand ein eigenes Sportsystem mit separaten Wettkämpfen, Ligen und Meisterschaften. In den fünf Jahren zwischen 1933 und 1938 hatte sich eine jüdische Sportbewegung entwickelt, deren Umfang und Bedeutung für das Alltagsleben im Zeichen antisemitischer Diskriminierung und Verfolgung von der Geschichtsschreibung bislang weitgehend unbeachtet geblieben ist.
Die beiden Sporthistoriker Lorenz Peiffer und Arthur Heinrich haben in ihrer beeindruckenden Publikation die Fakten nicht nur sämtlicher jüdischer Fußballvereine im regionalen Raum Nordrhein-Westfalens, die bis zum Novemberpogrom 1938 im nationalsozialistischen Deutschland existierten, sondern darüber hinaus sämtliche Sportaktivitäten von Juden – Turnen, Leichtathletik, Schwimmen, Handball und andere Sportarten mehr – zusammengetragen und in einer Sammlung mit Handbuchcharakter publiziert. Damit ist eine weitere historiographische Lücke der deutsch-jüdischen Beziehungsgeschichte geschlossen. Peiffer/Heinrich haben, wie schon in früheren Publikationen, unzählige regionale und überregionale jüdische Zeitungen und Archive auf der Suche nach relevanten Dokumenten durchforstet und ans Licht gebracht. Eine großartige Forschungsleistung, die beispiellos dasteht.
136 jüdische Vereinsgeschichten im Rheinland und Westfalen
Zu Beginn ihres Forschungsprojekts gingen die beiden Herausgeber von einer geschätzten Zahl von ca. 80 jüdischen Sportvereinen in Westfalen und im Rheinland aus. Im Laufe ihrer dreijährigen Recherchen konnten sie für die 1920er und 1930er Jahre immer mehr jüdische Vereine identifizieren, so dass sie schließlich 136 Vereinsgeschichten nachzeichnen konnten.
Seit 1925 bestand in der Region Nordrhein-Westfalen mit dem „Vintus“, der „Verband jüdisch neutraler Turn- und Sportvereine“, eine eigene jüdische Sportorganisation, nachdem der Westdeutsche Spielverband den Antrag der jüdischen Vereine auf Teilnahme an dem Wettkampfbetrieb und den allgemeinen Spielrunden abgelehnt hatte. Das heißt, dass antisemitische Ressentiments gegen jüdische Sportler längst gesellschaftlicher Standard waren, bevor die Nationalsozialisten im Januar 1933 die Macht an sich gebracht hatten. Der „Vintus“ wollte sich eigenem Selbstverständnis nach nicht vom allgemeinen Sport abkapseln, sondern gab als letztes Ziel die „Anerkennung durch die deutsche Sportbehörde“ aus. Der „Vintus“ organisierte mit bis zu 18 Vereinen von 1925 bis 1933 die erste eigenständige Fußballliga auf deutschem Boden. Die Geschichte dieser Organisation ist nunmehr erzählt.
Die Verdrängung von Juden aus öffentlichen Badeanstalten und Schwimmbädern durch Kommunalbehörden sind bezeichnend und stehen für eine bizarre Form von Diskriminierung: So wurde im Juli 1935 am Eingang des Stadions in Mülheim an der Ruhr (Styrum) ein Schild angebracht mit der Aufschrift: „Juden sind hier nicht erwünscht! Jude, ich rate Dir, bade im Jordan, aber nicht hier!“
Den Juden wurden die Schwimmbäder verboten
Die Antisemiten, in rassistische Wahnvorstellungen verfangen, besaßen tief sitzende Vorstellungen vom „unreinen“ Juden, der z. B. durch sein Schwimmen das Wasser vergifte, obsessive Phantasien, die möglicherweise in direkter Linie auf das Bild des brunnenvergiftenden Juden im Mittelalter zurückzuführen sind. Jean-Paul Sartre schrieb 1948: „Die Deutschen verboten den Juden als erstes den Zutritt zu den Schwimmbädern. Sie glaubten, das ganze Bassin würde verunreinigt, wenn der Körper eines Juden hineintauchte“.
Der jüdische Sport im nationalsozialistischen Deutschland hatte bereits seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten alle Stufen der Erniedrigung durchlitten: Den entehrenden Ausschluss aus der Sportgemeinde, die Entmündigung durch die deutsche Reichssportführung, Überwachung und Maßregelung durch die Geheime Staatspolizei. Juden konnten sich allein in rein jüdischen Vereinen sportlich organisieren und nur untereinander Sportwettkämpfe austragen. Ein Wettbewerb mit „arischen“ Vereinen war ausgeschlossen. Jüdischen Vereinen wurde die Benutzung öffentlicher Sportanlagen gekündigt und ihre Sportgruppen wurden durch SA und SS schikaniert. Eine beispiellose deutsche Sportgeschichte auch insofern, als gerade für Juden das tägliche Miteinander im Verein, Seite an Seite mit den christlichen Sportkameraden ein besonderes Zeichen ihrer gelungenen Emanzipation, Integration und Assimilation in der Umgebungsgesellschaft galt. Exklusion und Inklusion – Ausgrenzung und Entrechtung auf der einen, aber auch innerjüdische „Vergemeinschaftung“ und das Ringen um Selbstbehauptung auf der anderen Seite – bildeten die Extreme, die das jüdische Sportleben während der Jahre des Nationalsozialismus prägten.
Im Magazin „Turnen und Sport im Rheinland“ hieß es am 10. Mai 1933: „Die deutsche Turnerschaft hat mit ihrem Bekenntnis zum heutigen Deutschland und mit der Annahme des Arier-Paragraphen und der Neugestaltung ihres Betriebes im wehrturnerischen Sinn den Schritt des marschierenden Deutschlands aufgenommen. Die Juden und die entwicklungsfeindlichen Elemente sind in einer gewalttätigen Säuberungsaktion aus den Vereinen entfernt worden“.
Der Ausschluss jüdischer Sportler aus dem deutschen Sport war nur ein erster Schritt auf dem Weg zur „Arisierung“ des deutschen Sports, schreibt Lorenz Peiffer in seiner informativen, detailreichen Einleitung über die Wurzeln des jüdischen Sportlebens im Rheinland und in Westfalen bis zum Epochenjahr 1938. Und diese Aussage lässt sich auch ganz allgemein auf den jüdischen Sport in Deutschland übertragen. In einem zweiten Schritt auf dem Weg, sich für „judenfrei“ zu erklären, mussten die Spuren jüdischen Sportlebens getilgt und aus dem kollektiven Sportgedächtnis gelöscht werden. Lorenz Peiffer und Arthur Heinrich haben mit ihrem Handbuch einen wesentlichen Beitrag geleistet, deutsch-jüdischen Sport und seine Protagonisten wieder in das Bewusstsein der Gegenwart zu verankern.
Juden im Sport in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Ein historisches Handbuch für Nordrhein-Westfalen. Hrsg. v. Lorenz Peiffer u. Arthur Heinrich, Wallstein Verlag Göttingen 2019, 807 S., 49 Euro.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung