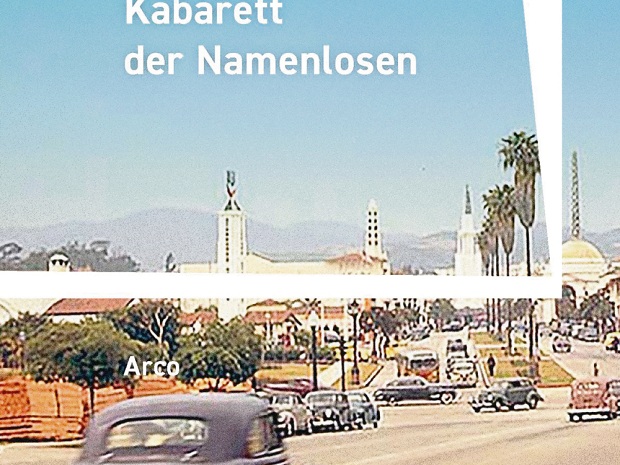„Eine entfernte Möglichkeit des Guten...“
Zum 100. Geburtstag des italienisch-jüdischen Autos, Chemikers und Holocaust-Überlebenden Primo Levi

Primo Levi
Es war einmal ein außergewöhnlich freundlicher, aber auch schüchterner Junge, am 31. Juli 1919 geboren in Turin, aufgewecktes Kind jüdisch-säkularer Eltern, deren Familien seit Jahrhunderten im Piemontesischen siedelten. Viele Jahrzehnte später, nun längst pensionierter Chemiker mit grauem Haar, doch noch immer mit weltneugierigen Augen, wird Primo Levi sein einstiges Ich auf diese Weise beschreiben: „Ich war ein Junge von vierzehn, fünfzehn Jahren, als ich beschloss, mich für die Chemie zu interessieren, weil ich begeistert war von der Parallelität zwischen der geschriebenen Formel und dem Vorgang im Reagenzglas.“
Bereits mit 23 Jahren dann trotz Mussolini‘scher Rassegesetze promoviert, wenig später Mitglied einer italienischen Partisanengruppe, kurz darauf auch als Partisan verhaftet, doch schließlich als Jude nach Auschwitz deportiert: Februar 1944.
Wie hatte er dort überleben können, fragt im Mai 1986 ein italienischer Journalist den inzwischen längst weltberühmten Autor von „Ist das ein Mensch?“, und Doktor Levi antwortet: „Ich war vom Glück begünstigt, weil ich Chemiker war, weil ich einem Maurer begegnete, der mir zu essen gab, weil ich die Hindernisse der Sprache überwand (das kann ich mir selbst zugute halten); ich bin nie krank geworden, nur ein einziges Mal am Schluss, und auch das war ein Glück, denn es hat mir die Evakuierung aus dem Lager erspart. Die anderen, die Gesunden, sind alle umgekommen, denn sie wurden mitten im Winter nach Buchenwald und Mauthausen verlegt.“
Biochemische Science-Fiction
Das Interview ist nur eines von vielen – Primo Levi ist häufig im Radio zu hören und im Fernsehen zu sehen, in der Zeitung „La Stampa“ hat er seit vielen Jahren eine regelmäßige Kolumne (in der deutschen Buchfassung unter dem Titel „Die dritte Seite“), und seine fast ausnahmslos preisgekrönten und in alle Weltsprachen übersetzten Bücher thematisieren nicht nur Auschwitz, sondern die Grundbedingungen menschlicher Existenz schlechthin, inklusive Gedichte und einiger zum Teil durchaus ironischer Story-Ausflüge ins Genre der „biochemischen Science-Fiction“, wie sein Schriftstellerfreund Italo Calvino anerkennend schreibt.
Galt also weiterhin, was in Levis Erinnerungen seine Jugendfreunde zu ihm gesagt hatten, als er nach der Befreiung von Auschwitz – und einer mehrmonatigen, im Buch „Die Atempause“ geschilderten Odyssee durch Osteuropa – im Oktober 1945 endlich wieder in seine geliebte Vaterstadt Turin zurückkehren konnte, in den Kreis seiner Familie, die die Schoah ebenfalls überlebt hatte? „Komisch, du bist der Alte geblieben...“ Ein stets zuvorkommender, wenngleich ein wenig distanzierter Zeitgenosse, Jahrhundertzeuge, Wissenschaftler, Schriftsteller und Familienmensch, der mit seinem Interviewpartner Ferdinando Camon dann sogar noch im April 1987 rege kommuniziert.
„Levis letzter Brief erreichte mich erst zwei, drei Tage nach seinem Tod, und es war ein Brief so voller Pläne, Wünsche und Erwartungen, dass er mir ganz unvereinbar erschien mit irgendeiner Absicht, zu verschwinden und Schluss zu machen. Dieser Brief hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass Primo Levis Tod ein Unfall war, oder, wenn er doch gewollt war, dass dieser Wille in keiner Weise in ein System passte und nicht nach einem Plan vollzogen worden war.“
Sturz in den Tod
Und doch hatte sich Primo Levi an jenem 11. April in den Aufzugsschacht seines Wohnhauses in den Tod gestürzt, vier Tage vor Beginn des Pessach-Festes, das dem Auszug des Volkes Israel aus ägyptischer Sklaverei gedenkt. Der a-religiöse Intellektuelle hatte freilich schon zuvor häufig jene Zeilen aus T.S. Eliots Gedicht „Das Begräbnis der Toten“ zitiert (wahrscheinlich nicht wissend um den Antisemitismus des englischen Lyrikers): „April ist der grausamste Monat, er treibt/ Flieder aus toter Erde, er mischt/ Erinnern und Begehren,/ weckt/ Dumpfe Wurzeln mit Lenzregen.“ Und hatte er nicht überdies, seit dem KZ an Depressionsschüben leidend, die er bislang domestizieren konnte, in letzter Zeit immer häufiger über das Gefühl tiefer Müdigkeit und Arbeitsunlust geklagt, einhergehend mit familiärer Überforderung? „Meine alte Mutter leidet an Krebs, und jedes Mal, wenn ich ihr Gesicht ansehe, erinnere ich mich an die Gesichter der Männer, die bewegungslos auf den Bretterlagern von Auschwitz lagen.“
Und dennoch – oder es wie in Ferdinand Freiligraths berühmtem Gedicht so tapfer heißt: Und trotz alledem und alledem. Denn trotz dieses Suizids aus Verzweiflung: Das Dunkle, Wortlose und vermeintlich Unsagbare, dem Primo Levi – Feind jeglichen Kitschs und vage wabernder Metaphysik – zeitlebens nicht allein thematisch, sondern auch in seinem kristallinen Stil den Kampf angesagt hatte, soll und darf nicht als das Letztgültige missverstanden werden. Levi, einer der wichtigsten Zeugen des Holocaust und gleichzeitig unermüdlicher Prüfer und Sondierer jener „Chemie“, die zwischen Menschen entsteht, hat uns nämlich seine Bücher hinterlassen und damit die Pflicht zu einer Erinnerung, die weihevolle Rhetorik verschmäht: „Ein Menschentypus, dem ich misstraue: dem Propheten, dem Verkünder, dem Seher. All das bin ich nicht. Ich bin ein normaler Mensch mit gutem Gedächtnis, der in einen Wirbel geraten und mehr aus Glück als aus eigenem Verdienst wieder herausgekommen ist, und der seitdem eine gewisse Neugier für Turbulenzen hegt, für große und kleine, metaphorische und materielle.“
Illusionslos, präzise, lakonisch
Was macht Levis Bericht „Ist das ein Mensch?“ – zuerst 1947 in kleiner Auflage erschienen und anfangs ebenso wenig wahrgenommen wie die deutsche Übersetzung von 1961 – zu einem solchen Jahrhundert-Buch, das in Italien nun längst Schullektüre ist und inzwischen weltweit als der Referenztext über die Welt des Lagers gilt? Vielleicht ist es ja eben das: Dieser präzise, lakonische, ja geradezu klassische Bericht-Stil des jungen Überlebenden, das illusionslose Sich- und die Umwelt-Beobachten als Überlebensstrategie, die Klarheit, die aus jeder Zeile spricht. „Denn für uns ist das Lager keine zeitlich bemessene Strafe; für uns ist kein Termin gesetzt, und das Lager ist weiter nichts als die uns zugedachte, unbefristete Existenzart innerhalb des deutschen Sozialgefüges.“ Primo Levi lässt keinen Zweifel daran, dass bereits dies die Ausnahme war: Kinder, Alte, Kranke und die meisten Frauen wurden sofort an der Rampe von Birkenau „selektiert“ und ins Gas getrieben, während für die Zwangsarbeiter etwa in Auschwitz-Monowitz eine Überlebenszeit von drei Monaten vorgesehen war, ehe aus dem besetzten Europa neue Sklaven herbeitransportiert wurden. Fast alle der zusammen mit ihm eingelieferten italienischen Juden gehen bereits in den ersten Wochen zugrunde; da sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind, verstehen sie die Kommandos nicht, werden zur bevorzugten Zielscheibe der sadistischen Kapos, werden von der SS zu Tode geprügelt oder verhungern und erfrieren. Primo Levi aber bringt sich in verzweifelter Schnelligkeit deutsch bei und wird schließlich in einem Chemie-Labor der IG Farben angestellt, wo er sich durch kleine Brotschmuggeleien und Ähnliches jeden Tag ein fragiles Überleben erkämpfen kann. Die Geschichte seiner erneuten „Chemieprüfung“ unter der Aufsicht jenes eiskalt-effizienten Dr. Pannwitz ist längst kanonisch geworden: Grauenerregende Innenaufnahme einer technizistischen Zivilisation auf rassistischem Fundament, in welcher der jüdische Doktor eben kein Mensch ist, sondern eine Sache, die es für bestimmte Zeit zu nutzen gilt.
Eine eigene KZ-Sprache wäre entstanden
Wie lässt sich eine solche Welt beschreiben, ohne in hilflos humanistische Floskeln wie „mitleidlose Hölle“ oder „unmenschliches Inferno“ abzudriften? Vielleicht allein auf diese Weise, die unsere limitierte Vorstellungskraft benennt – und dadurch zu weiten vermag: „Wir sagen ‚Hunger‘, wir sagen ‚Müdigkeit‘, ‚Angst‘ und ‚Schmerz‘, wir sagen ‚Winter‘, und das sind andere Dinge. Denn es sind freie Worte, geschaffen und benutzt von freien Menschen, die Freud und Leid in ihrem Zuhause erleben. Hätten die Lager länger bestanden, wäre eine neue, harte Sprache geboren worden; man braucht sie einfach, um erklären zu können, was das ist, sich den ganzen Tag abzuschinden in Wind und Frost, nur mit Hemd, Unterhose, leinerner Jacke und Hose am Leib, und in sich Schwäche und Hunger und das Bewusstsein des nahenden Endes.“
Jedem von uns, der bei den Begriffen „Überlebender“ und „Befreiung des KZ Auschwitz“ aufatmet und ein vages „Ging ja doch noch gut aus“ denkt, seien die Schlussszenen von „Ist das ein Mensch?“ empfohlen: In der Nacht des 18. Januar 1945 zieht die SS ab, mit ihr Abertausende Zwangs-Evakuierte, die in den nächsten Tagen und Wochen zu Tode kommen würden. Im von Bomben getroffenen und teilweise brennenden Lager gibt es ab jetzt nur noch die zurückgelassenen Kranken, ausgemergelte Ruhr-Patienten, die ihre Notdurft nicht mehr kontrollieren können und wie lebende Tote im Schnee umherwanken; Eiseskälte und fortgesetzter Kampf um ein Stückchen Brot. Als schließlich die Rote Armee einrückt, ist Doktor Levi gerade damit beschäftigt, erstarrte Leichen, darunter jene seiner Freunde, von Bahren in den von Kot verschmutzten Schnee zu kippen. Und schreibt dennoch vier Jahrzehnte später:
„Ich wiederhole: Nicht wir, die Überlebenden, sind die wirklichen Zeugen. Wir sind nicht nur eine kleine, sondern eine anomale Minderheit: Wir sind die, die den tiefsten Punkt des Abgrunds nicht berührt haben. Die Untergegangenen sind die Regel, wir die Ausnahme.“
Levis 1986 erschienener Essayband „Die Untergegangenen und die Geretteten“ steht zu seinem Hauptwerk in einem ähnlichen Verhältnis wie Imre Kertész´ Aufsatzsammlung „Eine Gedankenlänge Stille, während das Erschießungskommando neu lädt“ zu seinem lange zuvor erschienenen und späterhin mit dem Nobelpreis ausgezeichneten „Roman eines Schicksallosen“. Ebenso wie der ungarische Schoah-Überlebende wendet sich Primo Levi gegen das modische Bestreben, Auschwitz entweder zu einer Chiffre für jedes und alles zu machen oder es im Gegenteil derart zu sakralisieren, dass am Ende nur noch sterile Sonntagsrede bleibt. In seinen Essays erinnert Levi (der nach dem Krieg als erneut berufstätiger Turiner Chemiker ironischerweise auch Arbeitsbesuche bei der deutschen Bayer AG macht) an frühe bundesdeutsche Leser seines Buchs, die 1962(!) bekannten, sie hätten „genug vom ‚mea culpa‘-Geschrei der Presse und ihrer Lehrer“. Oder die Levis niemals hasserfüllte Diktion auf diese Weise missverstanden: „Lieber Herr Dr. Levi, so darf ich Sie einmal nennen, denn wer Ihr Buch gelesen hat, muss Sie lieb haben. Schwer lastet die Schuld auf meinem armen, betrogenen und irregeleiteten Volk. Freuen Sie sich jedoch des neu geschenkten Lebens, des Friedens und Ihrer schönen Heimat, die auch ich kenne. Auch auf meinem Bücherbord stehen Dante u. Boccacio. Ihr sehr ergebener T.H....“ Ohne das Wissen ihres Gatten hatte damals Frau H. freilich noch einen Zettel in den Brief gesteckt, auf dem sie sich für solch gutgelaunten Paternalismus entschuldigte.
Elende rechtslinke „Wer-war-schlimmer“-Aufrechnerei
In anderen Passagen seines Bandes beschäftigt sich Primo Levi detail-skrupulös mit der Lagererfahrung Alexander Solschenizyns und mit dessen Büchern und erinnert an das Schicksal der 1945 „befreiten“ sowjetischen Kriegsgefangenen, die als vermeintliche „Verräter“ in den stalinistischen Gulag transportiert oder sogleich erschossen wurden – auch dies ein intellektuell-ethisches Antidot zu jener elenden rechtslinken „Wer-war-schlimmer“-Aufrechnerei. Und dann, und auch dies ein Schlüsseltext, gedanklich stringent und stilistisch makellos: Angeregt von Jean Améry, eine Reflexion über die besondere Gefährdung des unpraktisch veranlagten, stets nach „Sinn“ suchenden Intellektuellen, dessen Bücherwissen im nihilistischen Lager nichts zählt und sogar seine Widerstandskraft schwächen kann. Im Wissen um Levis andere, beherzt weltausgreifende Bücher, liest man diese Seiten und sagt sich (dies wider besseres Wissen): Wenn es einer dennoch „geschafft“ hat, dann dieser Doktor Levi. Unmöglich also, dass einer schließlich doch noch „Hand an sich legt“, da ihm doch aus jener frühen Erfahrung radikalster Reduktion menschlichen Daseins diese Kräfte zur Gegenwehr erwachsen waren, eine Kreativität, die unter seinem jahrzehntelangen Lackfabrik-Job (er wird 1977 pensioniert) nicht gelitten hat und uns heute noch beglückt. Denn ja, dieses Wort Glück muss unbedingt sein in einem Erinnerungstext an jenen Schriftsteller, dem wir so zahlreiche existentiell entscheidende Bücher verdanken.
In seinem 1975 erschienenem „Periodischen System“ werden anhand des Charakters chemischer Elemente Etappen des eigenen Lebens erzählt; Saul Bellow mochte besonders dieses Buch und sorgte mit dafür, dass Levi auch in den Vereinigten Staaten bekannt wurde. Offenbart wird im verblüffend konzisen „Periodischen System“ auch der lebensweltliche Hintergrund von „Ist das ein Mensch?“: Zeitgleich mit der Niederschrift der Auschwitz-Erinnerungen war Levi in seinem ersten Nachkriegs-Brotjob in der Lackfabrik mit der Analyse eines Produktionsfehlers beauftragt worden.
Eine ganz normale Arbeit als Chemiker
Entfremdung vom Eigentlichen? Im Gegenteil: Schönheit und Würde der Arbeit, Eleganz und Glück genauen Messens, Kitzel der nun dem Zivilen dienenden chemischen Experimente – und Stimulanz fürs Schreiben, „das nun nicht mehr ein Betteln um Mitgefühl und freundliche Gesichter war, sondern ein Bauen bei klarem Bewusstsein, ohne das Gefühl der Einsamkeit.“ Denn just in jenen Winterwochen 1946 hatte Primo Levi auch seine zukünftige Frau kennengelernt: „Nach wenigen Stunden wussten wir, dass wir zueinander gehörten, nicht für eine zufällige Begegnung, sondern fürs Leben, wie es denn auch geschah.“
Wie es denn auch geschah... Schade, dass im allzu oft arg weihevollen Sprechen über diesen Ausnahme-Autor zumeist gerade das fehlt: Das eroberte Glück und die Fähigkeit zu präziser Erinnerung, die Mehrfach-Begabung des Intellektuellen, Schriftstellers und Chemikers aus Passion. „Der Gegner war ja noch immer derselbe, das Nicht-Ich, die dumme Materie, feindselig-träge wie die menschliche Dummheit und wie diese stark in ihrem passiven Stumpfsinn.“ Levi hielt deshalb nichts von einer Verteufelung des Technischen, wie es auf höchst verschwiemeltem Niveau der ehemalige Hitler-Bewunderer Heidegger tat, um die nazistischen Menschheitsverbrechen nun in einer generellen Zivilisationskritik zu nivellieren. Aber auch der linke Sprech, nach welchem „Fabrikarbeit gleich KZ“ sei, ging Primo Levi gegen den Strich.
Technik-Roman
Literarisches Resultat dieser frohgemuten Wertschätzung handwerklicher Arbeit ist der Roman „Der Ringschlüssel“, nach dessen Lektüre man keinen Monteur wieder ignorant übersehen wird. Welch gelungene, empathische Ausweitung der Aufmerksamkeitszone! Als das Buch 1978 erschien, meldeten sich im italienischen Fernsehen zahlreiche Arbeiter und Auslands-Monteure, um Levis pikaresken Technikabenteuer-Roman zu preisen: Ja, genau so ginge es zu ihrer Welt der Destillierapparate, Schweißgeräte und Ringschlüssel! Und auch das eine Glückserfahrung beim Lesen: Jene „entfernte Möglichkeit des Guten“, nach welcher Primo Levi in Auschwitz so verzweifelt gesucht hatte – sie existiert ja trotz alledem und alledem. Und findet ihren wohl kraftvollsten Ausdruck im 1982 erschienenem Roman „Wann, wenn nicht jetzt?“, der die spannende Weltkriegs-Geschichte russischer und polnischer Partisanen erzählt, mutiger linker Herzenszionisten, die hinter den Linien die deutsche Truppen angreifen, sich tunlichst von den NKWD-dominierten sowjetischen Einheiten fernhalten, Tod und Kälte trotzen und schließlich bei Kriegsende den Weg nach Italien finden, um von dort übers Mittelmeer hinüberzusetzen nach Eretz Israel.
Was also, wenn wir diesen wunderbaren Doktor Levi, dessen 100.Geburtstag sich in diesen Tagen jährt, so in Erinnerung behalten würden – als Lebenden, mit dieser immensen Wertschätzung für all die Geschichten, die erzählt werden müssen, aber auch erzählt werden können? „Es ist nicht wahr, dass Unordnung sich nur durch Unordnung darstellen ließe; es ist nicht wahr, dass das Chaos des beschriebenen Blatt Papiers das beste Sinnbild ist für jenes endgültige Chaos, das uns erwartet: dieser Glaube ist ein typisches Laster unseres Jahrhunderts der Unsicherheit. Da wir Lebenden aber nicht allein sind, sollten wir auch nicht so schreiben, als wären wir allein.“
Wer Primo Levi liest, wird nie wieder allein sein. Ein größeres Geschenk kann ein Mensch einem anderen nicht machen.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung