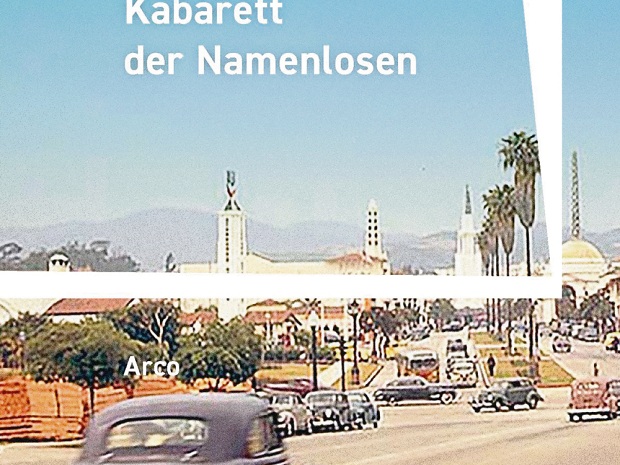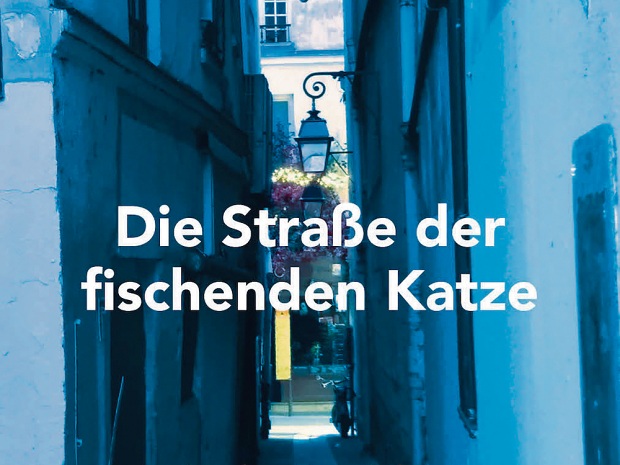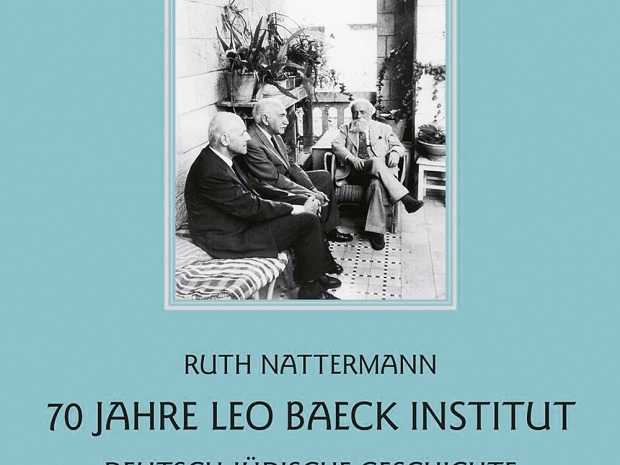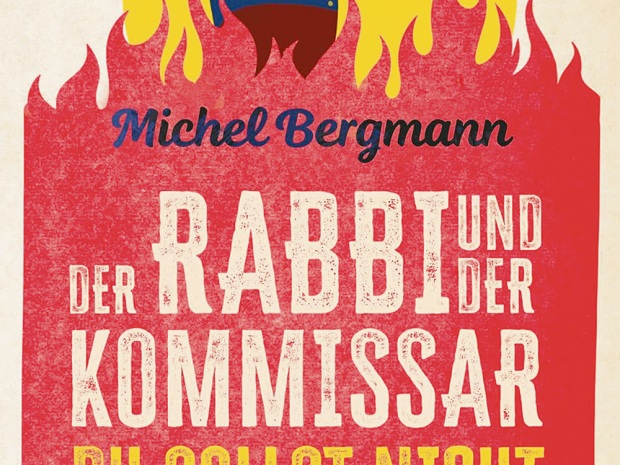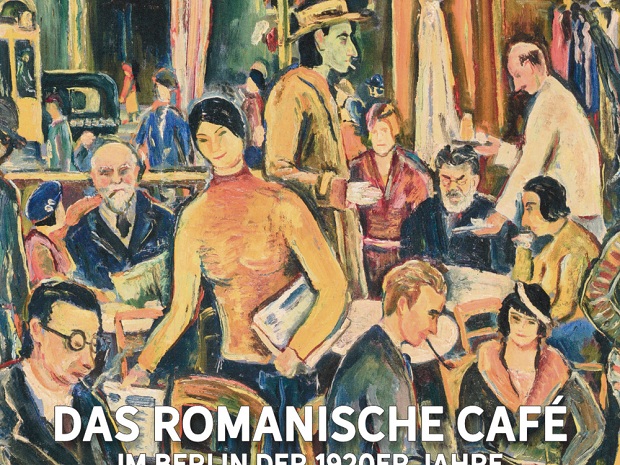Aus der Reihe jüdische Miniaturen: „Ostjüdische Arbeiter im Ruhrgebiet 1915–1923“
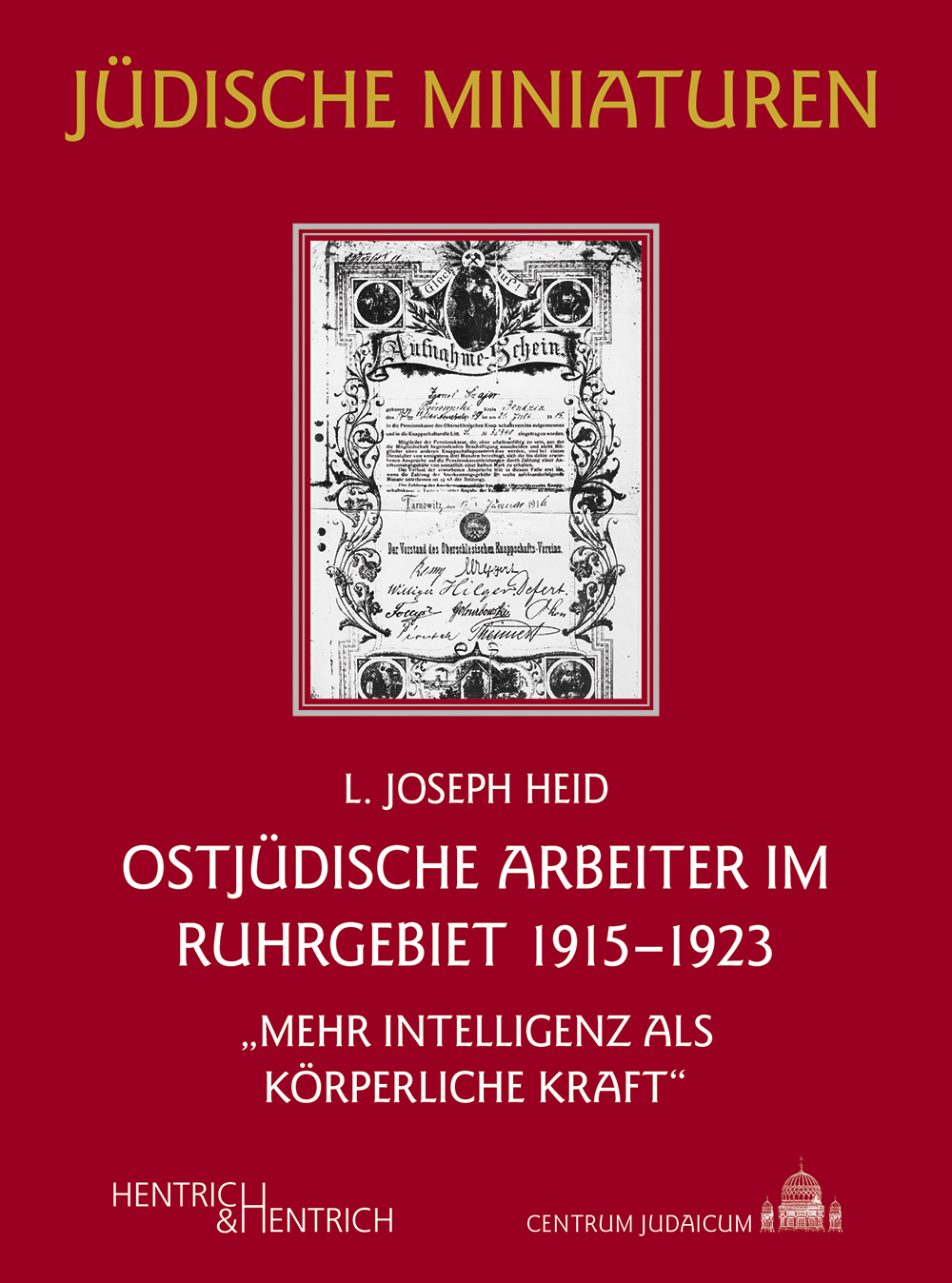
Der enorme Bedarf an Arbeitskräften während des Ersten Weltkrieges veranlasste Militär und Wirtschaft, zur Ankurbelung der deutschen Rüstungsindustrie, ausländische Arbeiter auch schon im Weltkrieg I unter Zwang für die deutschen Fabriken zu rekrutieren. Unter den Arbeitern aus dem russisch-polnischen Besatzungsgebiet befanden sich auch etwa 150.000 sog. Ostjuden. Allein 4.000 von ihnen arbeiteten als Kumpel in den Kohlegruben des rheinisch-westfälischen Industriegebietes unter Tage. Die Geschichte der ostjüdischen Arbeiter ist von der deutschen wie der deutsch-jüdischen Historiographie lange Zeit unbeachtet geblieben. Dieser Band schildert die spezifischen sozialen, politischen, kulturellen und religiösen Beziehungen der ostjüdischen Proletarier in einer ihnen ablehnend gegenüberstehenden deutschen Gesellschaft. (JR)
Als Band 326 ist jetzt in der verdienstvollen und seit vielen Jahren etablierten Buchreihe „Jüdische Miniaturen“ des Hentrich & Hentrich Verlages das Buch „Ostjüdische Arbeiter im Ruhrgebiet 1915-1923“ des Duisburger Historikers L. Joseph Heid erschienen. Die Themen „Juden in der Arbeiterbewegung“, „Juden im Sozialismus“ sowie „Juden im Ruhrgebiet“ gehören seit vielen Jahrzehnten zu den Forschungsschwerpunkten von Heid.
2011 ist im Essener Klartext Verlag bereits eine umfangreiche Studie von Heid zu den Ostjuden im Ruhrgebiet erschienen. Sie trägt den Titel „Ostjuden. Bürger, Kleinbürger, Proletarier. Geschichte einer jüdischen Minderheit im Ruhrgebiet“. Heids Neuerscheinung ist jedoch nicht einfach eine Fassung der großen wissenschaftlichen Studie zu den Ostjuden „en miniature“ oder eine zusammenfassende Information für ein größeres Publikum. Seit 2011 hat sich nämlich die politische Haltung bzw. Einstellung dieses größeren Publikums in Deutschland und anderswo so einschneidend verändert, dass sich Heids kleine Studie über die „Ostjüdischen Arbeiter“ nicht mehr nur einfach als historische Studie lesen lässt, sondern auch als hochaktueller Kommentar zur gegenwärtigen politischen Situation und Diskussion über das Thema „Antisemitismus“ sowie das Thema „Fremd-, Saison- und Sklavenarbeiter“ verstanden werden kann.
Erschreckende Aktualität
In zahlreichen Formulierungen in Heids Text steckt eine schneidende Aktualität, die erschreckt. Das trifft bereits auf den Untertitel dieses Buches „Mehr Intelligenz als körperliche Kraft“ zu, die heute nach der Wiederaufnahme zahlreicher antisemitischer Stereotype in den öffentlichen Diskurs über jüdisches Leben nicht mehr als historische Reminiszenz gelesen werden kann. Die Formulierung steht 1917 in einem Erlass des preußischen Innenministers Friedrich Wilhelm von Loebell, der die aufgrund von Mangelernährung in einer schwächeren körperlichen Konstitution befindlichen ostjüdischen Arbeiter in Berufe einzusetzen empfahl, die „mehr Intelligenz“ erforderten. Dahinter steckt jedoch das antisemitische Stereotyp vom arbeitsscheuen, für körperliche Arbeit ungeeigneten Juden, das sich auch heute noch unverändert im Arsenal einfallsloser Antisemiten befindet.
Heids Studie über „Ostjüdische Arbeiter“ beginnt mit diesem Thema, weil es „Arbeit und Alltag ostjüdischer Proletarier“, so auch der Titel des ersten Kapitels, mitprägte. Ausländische Bergmänner wurden im 19. Jahrhundert ins Ruhrgebiet gelockt, um den hohen Bedarf an Arbeitskräften im Bergbau abzudecken. Jüdische Arbeiter aus Russisch-Polen kamen hingegen während des Ersten Weltkrieges teils freiwillig, teils zwangsverpflichtet, ins Ruhrgebiet. In den besetzten östlichen Gebieten befahl man ihnen, sich auf Marktplätzen und Kirchhöfen zu versammeln, umstellte sie dann und transportierte sie anschließend nach Deutschland. Dort wurden sie vielfach auch in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Rückblickend aus dem Jahr 1921 resümiert die „Jüdische Arbeitsstimme“, dass mit diesem Einsatz „ein neuer Typus in der jüdischen Arbeiterbewegung“ geschaffen wurde, der „die Legende der Unfähigkeit des jüdischen Arbeiters zur Schwerarbeit zerstört“ habe.
Wie diese ostjüdischen Arbeiter im Ruhrgebiet lebten, erfährt man in diesem und den folgenden Kapiteln, die jeweils einen Aspekt ihrer Lebenswelt in den Mittelpunkt stellen. Im Kapitel „Lohn“ erfährt man etwas über die oppressiven Maßnahmen der Behörden zur Regulierung der Lebensumstände der Ostjuden. Nicht nur war ihre Bewegungsfreiheit auf den jeweils ihnen zugewiesenen Stadtbezirk beschränkt, sie konnten auch über ihren Lohn nicht verfügen. Dieses Recht lag bei ihren Arbeitgebern, die auch einen großen Teil des Lohns an die Familienangehörigen in den besetzten Gebieten weiterleiteten. Das schränkte die Lebensgestaltung der unverheirateten Männer drastisch ein, verhinderte aber auch den unerwünschten Nachzug von Familienangehörigen. Auch den Sorgen der ostjüdischen Arbeiter um das Wohlergehen ihrer Familien in der kriegsbesetzten Heimat wollte man auf diese Wese entgegenwirken.
Ein Stück Würde
Wie schwierig es war, der Zwangsunterbringung in Massenquartieren mit ihren unwirtlichen bzw. brutalen Verhältnissen durch Umzug in Privatunterkünfte zu entkommen, beschreibt Heid an einigen Beispielen im Kapitel „Kost und Schlafgänger“, aber auch im abschließenden Kapitel „Fallbeispiel: Salomon Sagel“. Mit der Darstellung des persönlichen Schicksals von Salomon Sagel erfüllt Heid nicht nur die Pflicht, die Gruppe der ostjüdischen Arbeiter aus ihrer Anonymität zu holen, sondern er wirkt damit auch dem antisemitischen Klischee vom Vorrang der Rasse als alleiniger Prägung des Exemplars entgegen. Indem er die individuellen Lebensumstände, Verhaltensweisen und Gefühlswelten eines osteuropäischen Juden aus den Archiven zu rekonstruieren versucht, gibt er ihm jene Würde zurück, die ihm seine über sein Leben bestimmenden Vorgesetzten damals nicht zugestehen wollten.
Als erste Archivquelle führt Heid die Ablehnung von Sagels Gesuch an, in seine Heimatstadt Warschau zur Beerdigung seiner mit 18 Jahren verstorbenen Schwester reisen zu dürfen.
Das religiöse Leben der ostjüdischen Arbeiter fern der Heimat fasst Heid in dem Satz zusammen: „Allgemein lässt sich feststellen, dass der Großteil der ostjüdischen Arbeiter mit dem Grenzübertritt auch mit den traditionellen religiösen Bindungen brach.“ Dass ihre Arbeitgeber selbst auf eine solche religiöse Lebensführung ihrer von den christlichen Arbeitern unterschiedenen jüdischen Arbeiter meist keine Rücksicht nahmen, ist jedoch eine eigene Geschichte, darf also nicht als Kehrseite für die Auflösung religiöser Bindungen verstanden werden. Nur noch einige ostjüdische Arbeiter befolgten die religiösen Gebote und Verbote. Die Kenntnis des biblischen Hebräisch sowie das religiöse Studium der Thora nahmen drastisch ab.
Vergessene
Arbeitergeschichte
Als Ausgleich wurden Arbeiterkulturvereine gegründet, die die Freizeitgestaltung sowie das Bildungsverlangen ausfüllen sollten. Sie waren jedoch, wie Heid schreibt, kein „Instrument einer Akkulturation an die deutsche Umgebungsgesellschaft“. Ihre kulturellen Initiativen blieben isoliert, weil sie auf die eigenen Bildungsbedürfnisse beschränkt blieben. Die ostjüdische Arbeiterbewegung war eine Wanderbewegung, die die Jahre eines politisch außergewöhnlichen Zustandes in Deutschland (Weltkrieg, Nachkriegszeig, Krisenjahre der Weimarer Republik) als Zwischenaufenthalt empfand. „Mit den weiterwandernden ostjüdischen Proletariern verschwanden zugleich die Träger einer besonderen Arbeiterkultur.“ Sie wanderten weiter in die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada, aber auch nach Palästina. Das heißt jedoch nicht, dass die kurze Geschichte der ostjüdischen Arbeiter als Marginalie der Arbeitergeschichte in Deutschland historisch übergangen oder vernachlässigt werden darf.
Bei der Verabschiedung des deutschen Steinkohlebergbaus im Jahre 2018 in Bottrop wurde, so Heid im Vorwort, die Geschichte der ostjüdischen Arbeiter mit keinem Wort erwähnt. Dabei lässt sich, liest man die kleine Studie von Heid, noch eingehender als an den unwürdigen Lebensverhältnissen der ausländischen, besonders der polnischen Bergleute, an den Umständen, unter denen die ostjüdischen Arbeiter ihren Arbeitseinsatz und ihr Leben in den Fabriken des Ruhrgebietes zu bewältigen hatten, vergleichsweise ersehen (siehe z.B. die Skandale der letzten Jahre in Teilen der deutschen Fleischindustrie), welche Rückstände, Demütigungen und Drangsalierungen auch heute noch bei dem Versuch bestehen, den richtigen Weg zu einer humanen Arbeitswelt für alle Arbeiter zu finden.
L. Joseph Heid, Ostjüdische Arbeiter im Ruhrgebiet 1915–1923. „Mehr Intelligenz als körperliche Kraft“, Verlag Hentrich & Hentrich, Berlin-Leipzig 2024, 76 Seiten, 8 Abbildungen, ISBN: 978-3-95565-684-3, 8,90 EUR
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung