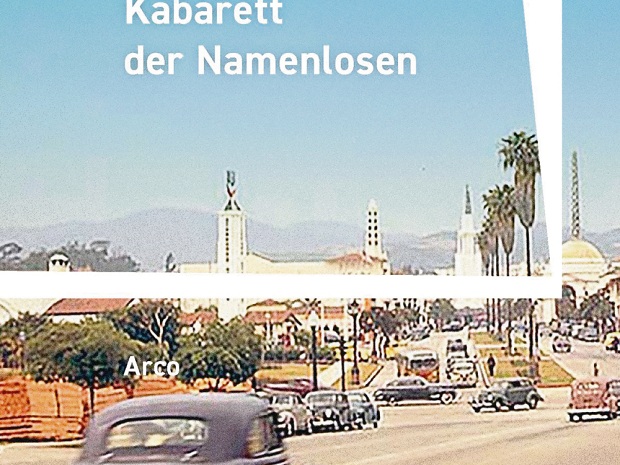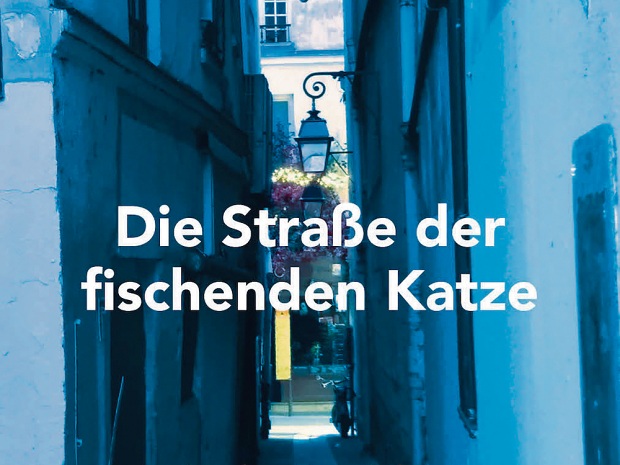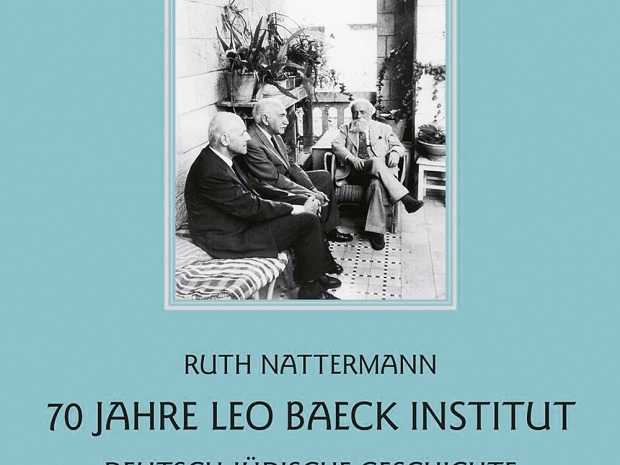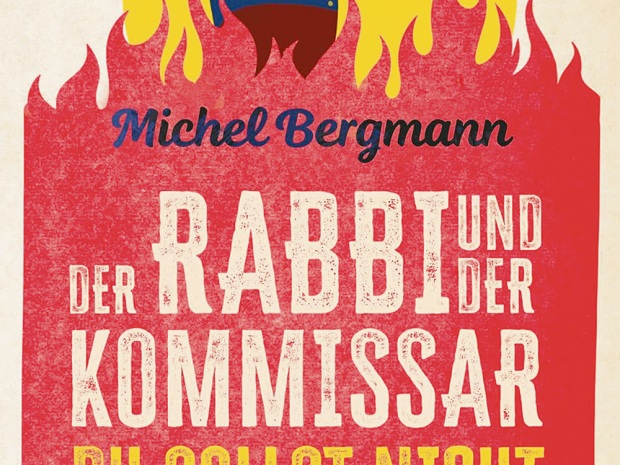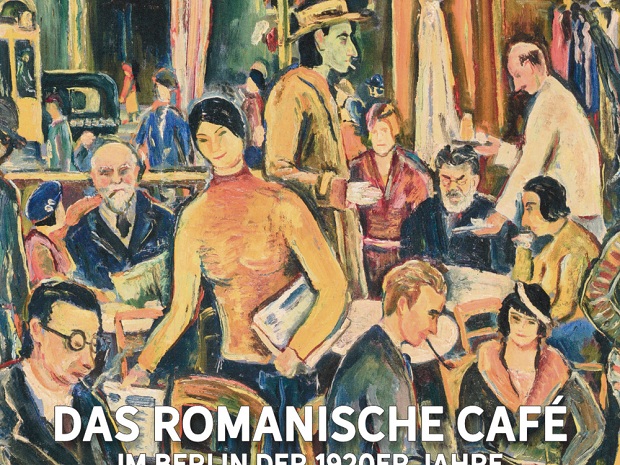Schäfer Peter: „Das aschkenasische Judentum – Herkunft, Blüte, Weg nach Osten“
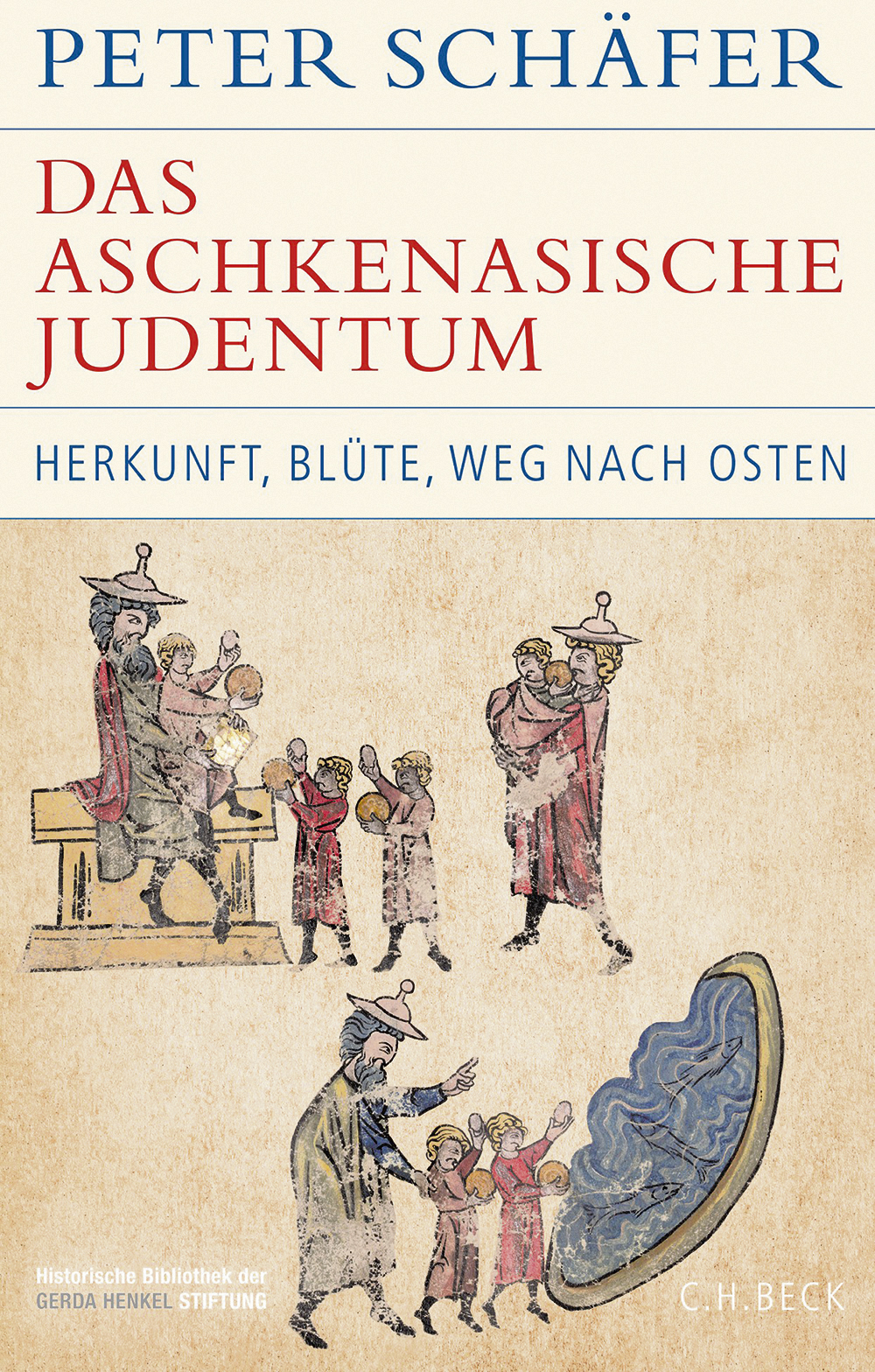
Der renommierte Judaist Peter Schäfer bietet mit seiner Untersuchung erstmals einen auf archäologischen und schriftlichen Quellen basierenden Überblick über Herkunft und Blüte des aschkenasischen Judentums und seinen erzwungenen Weg nach Osteuropa. Seine großartig erzählte Darstellung umfasst mehr als 2000 Jahre jüdischer Geschichte von der Antike bis zum 20. Jahrhundert und setzt damit einen neuen historiografischen Standard der Judaistik. (JR)
0In Genesis 10,3 wird das Wort „Aschkenas“ als der Sohn des Gomer, einen Nachfahren Nohas, vorgestellt. In einer anderen Bibelstelle wird die Ortsbezeichnung „Aschkenas“ in einem nicht näher bestimmten Norden erwähnt.
In der rabbinischen Literatur wird der hebräische Begriff „Aschkenas“, geografisch definiert und als Bezeichnung für „Mitteleuropa“, eigentlich für „Deutschland“, verwendet. Seit dem 12. Jahrhundert setzte sich der Begriff in der entstehenden mitteleuropäisch-jüdischen Literatur durch. Die ersten größeren jüdischen („aschkenasischen“) Gemeindegründungen erfolgten in den sogenannten ShUM Städten, die hebräische Abkürzung für die Gemeinden Speyer, Worms und Mainz. Zu ihnen gehörten bald auch wichtige Lehrhäuser, die herausragende rabbinische Gelehrte wie Raschi, Rabbenu Salomon Jitzchaki, anzogen. Weitere frühe Niederlassungen waren Metz, Trier und Köln, bald auch Magdeburg, Würzburg und Regensburg. In der Entstehungsphase von Aschkenas ließen sich Juden bevorzugt in Bischofsstädten mit Königsbindung nieder. Für diese Wahl waren vermutlich weniger religiöse als pragmatische Faktoren wie die Lage an Verkehrsachsen, Marktorte, Nachfrage, Kommunikationsmöglichkeiten oder Schutzfunktion ausschlaggebend.
Der Begriff „Aschkenas“ war zunächst nur auf das deutschsprachige Siedlungsgebiet beschränkt. So unterschied Raschi (gest. 1105 in Worms), ein französischer Rabbiner und maßgeblicher Kommentator des Tanach und Talmuds, in seinen hebräischen Kommentaren zwischen deutschen Wörtern („bi-leshon Ashkenaz“ = „in der Sprache Deutschlands“) einerseits und Wörtern („be-la’az“ = „in der Fremdsprache“), d. h. altfranzösischen andererseits. Durch zunehmende Migrationen wurde das Wort „Aschkenas“ für den gesamteuropäischen Siedlungsraum nördlich der Alpen und Teilen Osteuropas begrifflich verwendet. Die allmähliche Verlagerung des Zentrums von Aschkenas nach Osten war Folge der prekären Situation des Spätmittelalters, die durch Hungersnöte und Pest, Judenfeindschaft, Kriege und Autoritätsverlust von Papsttum und Feudalherren gekennzeichnet war.
Unterschiede zum Sefardentum
Als „aschkenasisch“ bezeichnet man die von Juden in Mittel- und Osteuropa übliche Aussprache-Tradition des Hebräischen, was sich in der gottesdienstlichen Liturgie bis in die Gegenwart erhalten hat. Das Aschkenasische hob sich vom Sefardischen vor allem dadurch ab, dass seine Tradition aus dem spanisch-iberischen oder südfranzösischen Umfeld schöpfte. Zwischen beiden kultur-traditionellen, religiösen, auch ethischen Richtungen gab es keinen Antagonismus oder eine Konkurrenz, auch wenn das Verhältnis nicht frei von Konflikten war. Das Gemeinsame der in sehr ungleichen Kulturkreisen lebenden Aschkenasen und Sefarden war, dass sie unter christlicher bzw. islamischen Oberhoheit lebten. Sie benutzten unterschiedliche Sprachen – Jiddisch bzw. Judenspanisch/Ladino - und praktizierten im Gottesdienst unterschiedliche Riten. In der Neuzeit wurde das mittelalterliche Aschkenas zu einem raum-zeitlichen Erinnerungstopos, als dessen wichtigstes Emblem seit dem 19. Jahrhundert die jiddische Sprache gilt.
Während die aschkenasischen Juden in Mittel- und später in Osteuropa Phasen friedlichen und fruchtbaren Miteinanders in ihrer christlichen Umwelt erlebten, und am Ende Opfer eines eliminatorischen Antisemitismus wurden, erlebten die sefardischen Juden nach einer langen „goldenen“ Blüte ab 1492 das Trauma einer einmaligen und flächendeckenden Vertreibung von der iberischen Halbinsel.
Auch wenn ihre Geschichte höchst unterschiedlich verlief, konnten und können beide Richtungen nebeneinander existieren: In Israel gibt es einen aschkenasischen und einen sefardischen Oberrabbiner.
Die Geschichte des Judentums ist eine Geschichte der Verfolgung und Zerstreuung wie sie im Psalm 137 beschrieben steht, wonach die exilierten Juden an den Flüssen Babels saßen und weinten, wenn sie an ihr angestammtes Land Israel zurückdachten. Jüdische Geschichte ist von Beginn an doppelgesichtig, eine Geschichte von Verwurzelung und Wanderung, eine diasporische Geschichte über Jahrhunderte und Länder hinweg. „Mutterland und Diaspora“, so Peter Schäfer, „waren und sind von jeher zwei Seiten derselben Sache, von denen keine Seite sich der anderen entledigen kann, ohne wesentliche Aspekte des Judentums aufzugeben“.
Blüte und Vernichtung
Der renommierte Judaist Peter Schäfer bietet mit seiner Untersuchung erstmals einen auf archäologischen und schriftlichen Quellen basierenden Überblick über Herkunft und Blüte des aschkenasischen Judentums und seinen erzwungenen Weg nach Osteuropa. Seine großartig erzählte Darstellung umfasst mehr als 2000 Jahre jüdischer Geschichte von der Antike bis zum 20. Jahrhundert und setzt damit einen historiografischen Standard der Judaistik, auch wenn er, eigener Selbstbestimmung nach, keine eigenständige Forschung, sondern die bisherige zusammenfassen wollte. Der Schwerpunkt seiner Studie liegt im Mittelalter. Die Geschichte der Aschkenasen in der Neuzeit bis in die Gegenwart wird – leider – nur knapp erzählt.
Schäfer zeichnet die Wanderungsbewegungen des aschkenasischen Judentums nach, woher diese kamen, wie sie ihre Gemeinden organisierten, wovon sie lebten und welche Beziehungen sie sie zu ihrer christlichen Umgebung unterhielten. Er beschreibt – jenseits der bis in die Gegenwart verbreiteten Klischeevorstellungen – den Alltag und die mystisch geprägte Frömmigkeit der aschkenasischen Juden. Er erzählt von den Verfolgungen und Vertreibungen im Spätmittelalter, der erneuten Blüte jüdischen Lebens in Polen, Litauen und Russland und vom Weg der Juden in eine ambivalente Moderne, die Emanzipation versprach und Vernichtung brachte. In der Gegenwart liegen die Zentren des aschkenasischen Judentums in den USA und Israel, doch seine Wurzeln reichen weit in das europäische Ostjudentum, in das mittelalterliche Deutschland und in die Antike zurück.
Im Hochmittelalter begann sich in Polen ein neues jüdisches Siedlungszentrum zu entwickeln, das seine Bedeutung bis ins 20. Jahrhundert behalten hat. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts verfolgte die polnische Krone eine planmäßige Besiedlungspolitik. Im agrarisch geprägten Polen sollten die Juden das fehlende Bürgertum ersetzen und dem Handel sowie dem Handwerk aushelfen. Sie unterlagen keinen obrigkeitlichen Beschränkungen, durften Grundstücke vom Adel und vom Klerus pachten und selbst in Besitz nehmen. Sie durften ihre Religion frei ausüben und über jüdische Autonomierechte verfügen. Die Masse der Juden unterschied sich kaum von ihrer christlichen Umwelt.
Entstehung und Blüte von Aschkenas wären nicht möglich gewesen, wäre seine Geschichte nur eine Abfolge von Verfolgung gewesen. Rechtlicher und religiöser Schutz erfolgte gleichwohl stets als Reaktion auf vorangegangene Gewalttaten. Je nach Zeit und Raum gab es immer wieder längere Phasen pragmatischer Koexistenz zwischen Christen und Juden.
Entstehung des Jiddischen
Die aus deutschen Gebieten vertriebenen und nach Polen zugewanderten Juden brachten als Sprache das Mittelhochdeutsche mit, das in hebräischen Lettern geschrieben und die Entwicklung zum Neuhochdeutschen nicht mitgemacht hatte. Diese Sprache vermischte sich mit hebräischen und slawischen Sprachelementen zu einer jüdischen Eigensprache, dem Jiddischen – und prägte sich zur Literatursprache aus. Der aus Polen stammende jiddisch schreibende Schriftsteller Isaac Bashevis Singer glaubte, als ihn 1978 die Nachricht erreichte, ihm sei der Nobelpreis für Literatur zugesprochen worden, an einen schlechten Scherz. Für den Preis bedankte er sich in Stockholm in der Sprache seiner jiddischen Herkunft. Und 1966, noch vor Singer, erhielt der aus dem aschkenasischen Judentum in Galizien stammende Samuel Joseph Agnon als erster hebräisch schreibender Schriftsteller den Literaturnobelpreis. Es sind diese modernen jiddischen und hebräischen Autoren mit den Wurzeln in Osteuropa, denen wir die Erinnerung an das in den deutschen Vernichtungslagern ermordete und über die ganze Welt verstreuten ostaschkenasische Judentum verdanken. (Ein anderer bedeutender Schriftsteller war der bulgarisch-britische Schriftsteller, Aphoristiker deutscher Sprache und Literaturnobelpreisträger 1981, Elias Canetti, der 1905 in eine sephardisch-jüdischen Kaufmannsfamilie hineingeboren wurde.)
Die Nähe zur deutschsprachigen Kultur kommt in der jiddischen Bezeichnung „teutsh“ oder schlicht „unzere shprokh“ für die Alltagssprache zum Ausdruck. Dies waren „goldene“ Jahre für das aschkenasische Judentum. Doch auch in Polen sollten alsbald Vorwürfe wegen Ritualmorde und Hostienschändungen gegen Juden erhoben werden, die sich in blutigen Verfolgungen Bahn brachen.
Geistige und kulturelle Entwicklung
Als Merkmal des aschkenasischen Judentums kann Gelehrsamkeit gelten. Als höchstes Ideal, das sich auch in schwierigen Zeiten behaupten konnte, prägte es das aschkenasische Selbstverständnis.
Trotz äußerer Bedrückung schritt die geistige und kulturelle Entwicklung voran, die in Osteuropa besondere Ausdrucksformen entwickelte: Eine zentrale Rolle spielte dabei der Chassidismus, dessen Begründer Israel Ben Eliezer (1700-1760) als Baal Schem Tow („Herr des guten Namens“) bekannt wurde. Seine Lehre, die um das Bemühen um eine lebendige Beziehung zu Gott kreiste, wurde von seinen Schülern in ganz Osteuropa verbreitet. Sie traf das tiefe Bedürfnis der jüdischen Massen nach einer unmittelbaren Frömmigkeit jenseits der von den Rabbinern eingeschärften Beobachtung des strengen Religionsgesetzes.
Am 11. Dezember des Jahres 321, also vor 1.700 Jahren, erließ der römische Kaiser Konstatin der Große ein Edikt, das festlegte, dass Juden städtische Ämter in der Kurie, der Stadtverwaltung Kölns bekleiden durften und sollten. Diese Urkunde belegt eindeutig, dass jüdische Gemeinden bereits seit der Spätantike wichtiger, integrativer Teil europäischer Kultur sind. Eine frühmittelalterliche Handschrift dieses Dokumentes befindet sich heute im Vatikan und ist Zeugnis der mehr als 1.700 Jahre alten jüdischen Geschichte in Deutschland und Europa.
Aufgrund dieses historischen Ereignisses hatte sich in Köln der „Verein 321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ gegründet und für das Jubiläumsjahr 2021 ein Großprojekt ausgelobt, dass die Anwesenheit von Juden in das kollektive Bewusstsein der Gegenwart gerückt hat. Das Festjahr 2021 war eine wichtige Gelegenheit, um auf die lange Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland und Europa zu verweisen. Zwischen dem Jahr 321 und den ersten belegbaren Hinweisen auf die Existenz einer Kölner jüdischen Gemeinde liegen jedoch „sieben dunkle Jahrhunderte“, zweifelt Schäfer, ohne jede Evidenz einer Anwesenheit von Juden in Köln oder anderswo auf deutschem Boden und so kommt er zu dem Schluss, dass die „angeblich“ 1700 Jahre jüdischer Präsenz in Deutschland um ca. 700 Jahre „zu hoch gegriffen“ seien.
Dreh- und Angelpunkt des religiösen und kulturellen Lebens der Aschkenasim war im Mittelalter geprägt von der Torah mit all ihren Auslegungen und praktischen Anwendungen. Die Torah war sozusagen der Inbegriff der jüdischen Wirklichkeit. Alle schulische Bildung hatte allein den Zweck, die Torah einzuüben. Und damit konnte das aschkenasische Judentum eigene Initiationsriten entwickeln und bewahren. Ein Beispiel: Die pädagogisch-didaktischen Erfolge beim Lernen der Kinder waren hoch, weil ungewöhnliche Methoden angewandt wurden: Dadurch, dass die Belohnung Teil des Lernrituals wurde – die Kinder durften Honig von den Buchstaben der Schreibtafel ablecken und zum Abschluss Honigkuchen und Ei essen -, betonte dieser aschkenasische Ritus die kinderfreundliche Seite der Erziehung.
Um den Lesern ein anschauliches Bild von den Besonderheiten des aschkenasischen Umgangs mit der Traditionsliteratur zu vermitteln, stellt Schäfer Beispiele ihrer Bibel- und Talmudauslegung in deutscher Übersetzung vor – ein Experiment, das die Bereitschaft der Leser erfordert, sich auf Details einzulassen, die ihnen wohl fremd und inhaltlich für sie nicht leicht nachzuvollziehen sind. Dabei ist sich Schäfer sicher, dass es möglich sei, jenseits der üblichen abstrakten Schablonen einen Eindruck davon zu gewinnen, wie die aschkenasischen Juden dachten und argumentierten, was ihnen wichtig war und was sie ignorierten.
Epizentrum des Antisemitismus
Der Antisemitismus ist eine anthropologische Konstante der abendländischen Kultur und Zivilisation, ein integraler Teil der historischen Erbmasse. Der Antisemitismus ist Teil und Erbe der christlichen Tradition, die auch nicht mit einem Bekenntnis zu den Werten der Aufklärung oder den Zielen des Sozialismus aus dem kollektiven Bewusstsein getilgt werden konnte. Er gehört sozusagen zum Weltkulturerbe mit seinem Epizentrum in Europa! Der erste dramatische Einschnitt im Leben der Aschkenasim waren die Kreuzzüge, die im Jahre 1096 mit einem Gemetzel in Mainz begannen und begleitet waren von eigenhändigen Tötungen ihrer Kinder als Opferhaltung zur „Heiligung des göttlichen Namens“. Die traumatischen Erfahrungen des Ersten Kreuzzugs haben sich fest im Gedächtnis des aschkenasischen Judentums verankert, um dann durch die Chmielnicki-Pogrome in Polen von 1648/49, den russischen Pogromen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und dem Holocaust „überboten“ zu werden.
Als Strategie gegen Verfolgungen diente den Aschkenasen ein gesteigertes Selbstbewusstsein in dem Versuch, den Zerstörungen jüdischer Gemeinden, der Ermordung ihrer Mitglieder und der präzedenzlosen Selbsttötungen während der Kreuzzüge etwas Tröstliches abzugewinnen. Die unerschütterliche Glaubenshingabe bis hin zum Martyrium ist ein Kennzeichen der mittelalterlichen Kultur von Aschkenas. Unstrittig waren die dauernden Verfolgungen unter christlicher Herrschaft eine existenzielle Herausforderung für die aschkenasische Gemeinschaft.
Haben wir uns in der Neuzeit vom Mittelalter gelöst oder sind wir noch immer in ihm verfangen? Man darf erinnern: Die mittelalterliche „Judensau“ z. B., die als Skulpturen und Bildmotive in zahlreichen Kirchen (Stadtkirche Wittenberg; Erfurter, Kölner, Magdeburger oder Xantener Dom) angebracht sind, haben durch die Jahrhunderte das Bewusstsein und das Denken der Menschen zutiefst geprägt – und prägen es heute noch. Das sind in Stein gemeißelte Zeugnisse, sind bildhafte, zum Handeln auffordernde Schmähungen, die zudem einen obszönen Charakter haben. Schimpfworte wie „Judensau“, „Judenschwein“ oder „Saujud“ haben in diesen Skulpturen ihren Ursprung. Weitere Stichworte sind: Ritualmordlegenden, Hostienfrevel, Brunnenvergiftung und vieles andere mehr. All dies trug zum Niedergang des westaschkenasischen Judentums bei. In Osteuropa hingegen konnten die Juden zu einer neuen Blüte gelangen, die im mystischen Chassidismus ihren Ausdruck fand, bis sie auch hier durch die erwähnten Verfolgungen ihrem Untergang nicht entkommen konnten. Den zahlreichen jiddisch schreibenden Autoren, die ihre Wurzeln in Osteuropa hatten, verdanken wir die Erinnerung an das in den deutschen Todeslagern ermordeten und über die Welt verstreute ostaschkenasische Judentum.
Es bleibt, wie es ist: Das jüdische Leben in Aschkenas ist auf untrennbare Weise europäisch und jüdisch zugleich gewesen, eine Aussage, die auch in der Gegenwart Bestand hat, was immer unbelehrbare Ignoranten hartnäckig leugnen wollen.
Peter Schäfer. Das aschkenasische Judentum. Herkunft, Blüte, Weg nach Osten, Verlag C. H. Beck, München 2024, 560 S., 39 Euro.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung