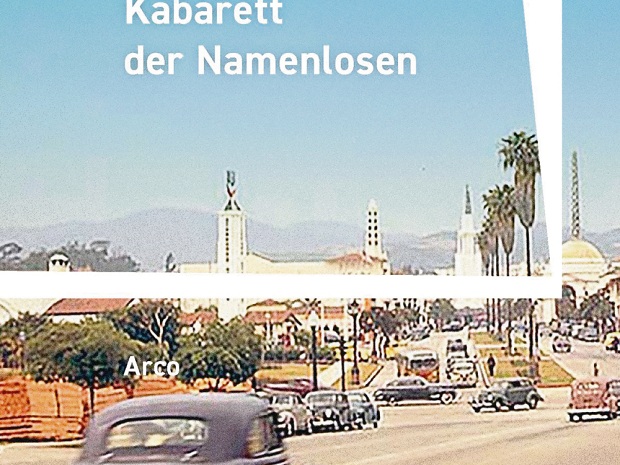Franz Kafka – Eine Erinnerung zum 100. Todestag

„Franz-Kafka-Kopf” in Prag. 42 bewegliche Ebenen der elf Meter hohen Skulptur formen das Gesicht des bekannten Schriftstellers Franz Kafka.© MICHAL CIZEK/AFP
Das Geheimnis des jüdisch-tschechischen und wohl wirkungsmächtigsten Schriftstellers des 20. Jahrhunderts zu enträtseln, daran haben sich ganze Generationen von Sprachwissenschaftlern, Judaisten oder Historikern versucht. Franz Kafkas künstlerische Individualität speist sich aus ihrer besonderen Stellung zwischen jüdischem Mythos und europäischer Moderne und wird begünstigt durch die Universalität seiner damals dem österreichischen Kaiserreich zugehörigen Prager Heimat. (JR)
„Ich bin Ende oder Anfang“, sagte Franz Kafka einmal über sich. Ein Satz so geheimnisvoll wie er schrieb: kryptisch, vielsagend, tiefgründig, mehrdeutig. Kafkas Literatur bildet einen Raum, in dem Phantasie und Realität nicht mehr zu trennen sind. Das Geheimnis des wohl wirkungsmächtigsten Schriftstellers des 20. Jahrhunderts zu enträtseln, daran haben sich ganze Generationen von Sprachwissenschaftler, Judaisten oder Historiker versucht. Seine künstlerische Individualität speist sich aus ihrer besonderen Stellung zwischen jüdischem Mythos und europäischer Moderne als Besitz eines sich vor dem Vater fürchtenden ewigen Sohns, der sich tatsächlich am Anfang und am Ende aller Überlieferungen stehen sieht. Das galt auch für sein Judentum, an das er sich gefesselt fühlte. Seinem Freund Max Brod gestand er, auf das Verhältnis von Juden zu ihrem Judentum anspielend: „Weg vom Judentum wollten die meisten, die deutsch zu schreiben anfingen, aber mit den Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters und mit den Vorderbeinchen fanden sie keinen neuen Boden“.
Kafkas Religiosität
An seinem Judentum „klebte“ Kafka freilich nicht von Anfang an: Seine religiösen Aktivitäten beschränkten sich auf die drei großen Feiertage des jüdischen Festkalenders – Rosh ha-Shana, Pessach und Jom Kippur -, die von den „Dreitagejuden“ nicht immer mit letzter Konsequenz ernstgenommen wurden. In seiner Jugend absolvierte Kafka die Synagogenbesuche, so schreibt er, eher lustlos und gelangweilt und ohne das Bewusstsein, an einem heiligen Akt teilzuhaben, in einer Art Halbschlaf. Die Stunden des G‘‘ttesdienstes „durchgähnte und durchduselte“ er - so gelangweilt hatte er sich später nur noch in der Tanzstunde - ohne sich wirklich innerlich zugehörig zu fühlen. Es war der Angst geschuldet, er könne zur Aliyah, der öffentlichen Lesung der Thora, aufgerufen werden, was ihn, so erinnert er sich, in den Momenten des Dämmerns wachgehalten habe. Seine Bar-Mizwah im Jahre 1896, die der Vater der assimilatorischen Sitte gemäß als „Confirmation“ angekündigt hatte, bedeutete dem Dreizehnjährigen nichts als ein „lächerliches Auswendiglernen“. Mit einer abschätzigen Bemerkung blickte er zurück: „Ich suchte mich möglichst an den paar kleinen Abwechslungen zu freuen, die es dort gab, etwa wenn die Bundeslade aufgemacht wurde, was mich immer an die Schießbuden erinnerte, wo auch, wenn man in ein Schwarzes traf, eine Kastentür sich aufmachte, nur dass dort aber immer etwas Interessantes herauskam und hier nur immer wieder die alten Puppen ohne Köpfe.“ Indes blieb die Synagoge für Kafka ein heiliger Ort, an dem Spuren der Säkularisierung durchschimmerten.
Seine Begegnung mit Jizchak Löwy führte Kafka näher an die ostjüdische Welt mit all ihren religiösen und kulturellen Facetten. Kafka begegnete dieser Welt allerdings mit einer seltsamen Mischung von Begeisterung, Neugierde, Skepsis, Zustimmung und Ironie. Er fühlte sich gar in einer chassidischen Genealogie stehend, wenn er bekannte: „[…] ich heiße hebräisch Amschel, wie der Großvater meiner Mutter von der Mutterseite, der als ein sehr frommer und gelehrter Mann mit langem weißen Bart meiner Mutter erinnerlich ist. […] Sie erinnert sich auch an die vielen, die Wände füllenden Bücher“.
Kafkas Lektüre, soweit sie im Tagebuch, in Briefen und in seiner unvollständigen Bibliotheksliste dokumentiert ist, beweist sein anhaltendes Interesse an jüdischen Themen, an jiddischer Literatur, an jüdischer Religion, an religionsgeschichtlichen und religionsphilosophischen Werken überhaupt. Dass er mit dem Talmud vertraut war, das machen etliche Tagebuchpassagen sehr deutlich.
Parabeln nach jüdischer Tradition
In seinen literarischen Texten verhandelte Kafka dagegen nie explizit jüdische Themen, das Wort „Jude“ kommt in keinem seiner Romane und Erzählungen vor, gleichwohl implizit, anspielend, parabolisch. Er stellte sie weder in den Dienst des Zionismus noch in den der Assimilation. Walter Benjamin war wohl der erste, der in der Kafka‘schen Prosa das unmittelbare Echo der Thora und des Talmuds erkannte als er 1939 schrieb: „Ich denke mir, dem würde der Schlüssel zu Kafka in die Hände fallen, der der jüdischen Theologie ihre komischen Seiten abgewönne“.
Anders in seinen privaten Tagebuchaufzeichnungen, in denen Kafka sich durchaus an einer jüdischen Selbstbestimmung versuchte, Begeisterung für die ostjüdische Kultur zeigte. Dann auch ein anderes Bild, das auf seine brüchige religiöse und individuelle Selbsteinschätzung zeigt. So ein Tagebucheintrag vom 8. Januar 1914: „Was habe ich mit Juden gemeinsam? Ich habe kaum etwas mit mir gemeinsam und sollte mich ganz still, zufrieden damit, dass ich atmen kann, in einen Winkel stellen“.
Kafka war kein gläubiger praktizierender Jude, haderte mit seiner jüdischen Herkunft. Dennoch verdanken sich seine Parabeln von Schuld, Strafe und Erlösung der jüdischen Tradition. So sehr ihn die ostjüdische Frömmigkeit faszinierte, so sehr blieb er im Bodenlosen zwischen Verzweiflung und Erlösung: „ [… ich] habe nicht den letzten Zipfel des davonfliegenden jüdischen Gebetmantels noch gefangen wie die Zionisten. Ich bin Ende oder Anfang“.
Kafka wusste um seine Krankheit, und wenn er „irgendwie“ weiterleben wollte, so teilte er seiner Schwester Ottla in einem Briefe im Oktober 1923 mit, müsste er „etwas ganz Radikales“ tun – nach Palästina fahren. Ob er in diesem Zusammenhang an eine dauerhafte Niederlassung dachte, hatte er wohl für sich noch nicht entschieden. „Ich wäre ja dazu gewiß nicht imstande gewesen, bin auch ziemlich unvorbereitet in hebräischer und anderer Hinsicht, aber irgendeine Hoffnung mußte ich mir machen“, ließ er seine Schwester wissen. Er fuhr im Spätherbst 1923 nicht nach Jerusalem, sondern ging nach Berlin, um an der „Hochschule für die Wissenschaft des Judentums“ Hebräisch- und Talmudkurse zu belegen.
Sehnsucht nach Palästina
Ungeachtet all dieser ambivalenten Haltungen ermunterte Kafka andere zur Aliyah nach Palästina und fasste die Emigration als ungeheures, dem biblischen Schilfmeerwunder vergleichbares Ereignis auf. Er besuchte Filme und Vorträge über Palästina, wo immer sich die Möglichkeit dazu ergab, erkundigte sich über den Stand der zionistischen Kolonisationsbewegung. Obwohl ständig knapp bei Kasse spendete er für den „Jüdischen Nationalfond“ und äußerte einmal seine Absicht, ein Restaurant mit seiner letzten Freundin Dora Diamant als Köchin und ihm als Kellner in Tel Aviv eröffnen zu wollen – eine Schrulle, ein nachgerade kafkaesker Gedanke.
Mit der Theorie des Herzl‘schen Zionismus hat sich Kafka, soweit bekannt, jedoch nicht ernsthaft auseinandergesetzt. Kafkas zionistische Neigungen scheinen sich allenfalls nur auf eine bestimmte Periode in seinem Leben bezogen zu haben. Mag auch sein, dass er seine eigene Auswanderung nach Palästina als eine Möglichkeit angesehen hat, seine persönliche Lebensproblematik zu lösen. Die geschmiedeten Pläne einer Jerusalem-Reise musste er im Frühsommer 1923 wegen seiner fortschreitenden Krankheit aufgeben.
Kafkas intensives Hebräischlernen galt nicht allein der Vorbereitung auf einen Palästina-Aufenthalt, sondern war den Bemühungen geschuldet, sich die authentische Glaubenssprache erschließen zu wollen. Kafka nahm das Sprachstudium des Iwrith sehr ernst, so dass er sich zu Beginn der 1920er Jahre in Wort und Schrift ausdrücken konnte.
Das Judentum ist nicht nur der Schlüssel zu Kafkas Schicksal, sondern gleichermaßen der entscheidende Knotenpunkt zwischen seinem Leben und seinem Werk. Vor dem Hintergrund jüdischer Glaubenskultur ist die Voraussetzung von Kafkas ästhetischer Produktivität zu suchen. Wir wissen längst, dass Kafka eine zentrale Geistesgröße in diesem Kontext ist. Er war ein einsamer Flaneur, ein Reisender und Ängstlicher, ein Asket und ein Liebender, er war der Spezialist des Schreckens und ein Meister der Ironie.
Wir behelfen uns, wenn uns etwas absurd, abwegig oder anomal erscheint, mit dem Kunstwort „kafkaesk“, das uns als Erklärung ausreichen muss. Oder, in Kafkas eigenen „Prozess“-Worten ausgedrückt: „Je länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird man“. Franz Kafka starb am 3. Juni 1924, 40-jährig an Lungentuberkulose. Begraben wurde er auf dem Neuen Jüdischen Friedhof in Prag-Žižkov.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung