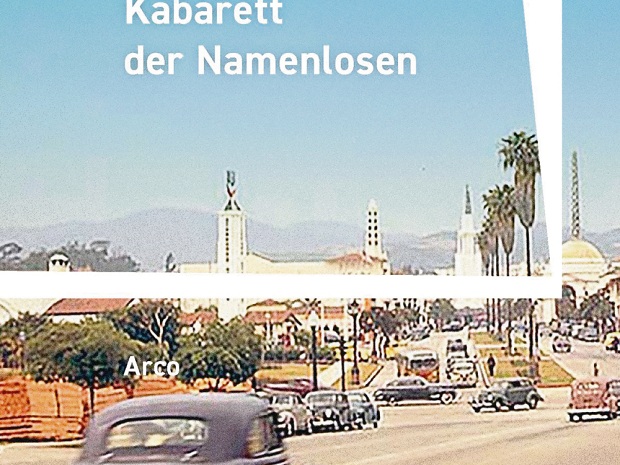Leseempfehlung: „Pogrom im Scheunenviertel: Antisemitismus in der Weimarer Republik und die Berliner Ausschreitungen 1923“

Am 5. November 1923 entzündete sich antijüdische Gewalt im Scheunenviertel von Berlin gegen die Ärmsten der Armen. Es war das Pogrom vor dem Pogrom – die Blaupause für die Judenvernichtung der Nationalsozialisten. Karsten Krampitz untersucht in diesem Buch, wie im Krisenjahr 1923 die verbale Gewalt nach und nach in physische Gewalt umschlägt. (JR)
1923. Was für ein ereignisreiches Jahr! Das Jahr 1923 war namentlich für die deutschen Juden von schicksalhafter Bedeutung. Aber auch für die Juden aus Osteuropa, die in der deutschen Innerpolitik die Schlagzeilen beherrschten. Franzosen und Belgier hatten als Folge ausbleibender Reparationszahlungen das Ruhrgebiet besetzt. Es gab hinsichtlich der Ausweisungspolitik einen ernsten Konflikt zwischen der Berliner Reichsregierung und dem bayrischen Generalstaatskommissar Gustav Ritter von Kahr. Dazu verbündete er sich unter anderem mit Adolf Hitler und der NSDAP, schlug deren Putschversuch im November 1923 jedoch nieder, da dieser seine eigenen Umsturzpläne durchkreuzte.
Kahr verfolgte eine antisemitische Politik, der drei Jahre zuvor im Zuge einer reichsweiten antisemitischen Kampagne erstmals die Massenausweisung sogenannter Ostjuden anordnete. Deutschland erlebte den Höhepunkt seiner Hyperinflation. Und ein außerhalb Bayerns noch recht unbekannter völkisch-radikaler Politiker namens Adolf Hitler versuchte sich vergebens am Staatsstreich. Fememorde der illegalen „Schwarzen Reichswehr“ waren an der Tagesordnung. Der Zentrumspolitiker Wilhelm Marx war deutscher Reichskanzler. Und Chaim Weizmann wurde Präsident der zionistischen Weltorganisation. All das, und noch viel mehr, geschah 1923.
1923 stand die Weimarer Republik am Abgrund. Mehr als vier Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs fehlte es vielerorts an Arbeit und Wohnungen. Kommunisten zettelten Aufstände an, Separatisten im Rheinland wollten sich vom Reich abspalten. Rechtsextreme ermordeten politische Gegner.
Von einem für die in Deutschland lebenden etwa 500.000 Juden neu-alten Ereignis war noch gar nicht die Rede: der Scheunenviertel-Pogrom im November 1923 in Berlin. Zum 100. Jahrestages der pogromistischen Ereignisse im Scheunenviertel hat jetzt der Historiker Karsten Krampitz eine Studie vorgelegt, die das historiografisch weitgehen vergessene Geschehen dort am 5. November 1923 neu aufrollt.
Ein kontrastreiches Viertel
Das Scheunenviertel war seit Ende der 1880er Jahre Anlaufpunkt für osteuropäische Juden, die vor Pogromen aus Russland fliehen mussten. Dort, wo sich seit dem 18. Jahrhundert die Scheunen Berlins befanden, siedelten die jüdischen Zuwanderer sich an. Die Gegend galt von jeher als verrufen: Das Scheunenviertel zwischen Hirten- und Linienstraße, einfach bebaut, wurde zum Schlupfwinkel der Kleinkriminalität, die Prostitution blühte. Im Kontrast dazu: Streng orthodoxe, chassidische Betstuben (Schtibl) und Talmudschulen. Koschere Restaurants und Metzger, Buchläden mit hebräischer Literatur. Traditionell gekleideten Jüdinnen und Juden beherrschten das Straßenbild. „Man sieht Juden mit Talles unterm Arm. Sie gehen aus dem Bethaus Geschäften entgegen“, beschreibt Joseph Roth in seinem wunderbaren Essay „Juden auf Wanderschaft“ die Scheunenviertel-Szenerie. Man lebte wie selbstverständlich jüdisch mit- und untereinander, wenngleich Antisemiten immer wieder diese geschlossener (ost)jüdische Welt und deren Kultur mit seinem „Untergrund“ für ihre Hasspropaganda zu nutzten suchten.
Über das ostjüdische Milieu in Berlin bei Ende des Ersten Weltkrieges schreibt die Rabbinertochter Klara Eschelbacher: „Berlin hat ... im Scheunenviertel sein typisches Ghetto. ... Die ostjüdische Hauptstraße hier, die Grenadiergass, bildet ein Städtchen für sich, mit ihren Leiden, Freuden und Hoffnungen, mit ihrer eigenen Sprache, Sitten und Gebräuchen, und steht in keinem Zusammenhang mit dem großen brausenden Berlin.“
Im Scheunenviertel wohnte nicht das deutsch-jüdische Establishment, im Gegenteil. Die autochthonen deutschen Juden sahen mit Argwohn auf die traditionellen Brüder und Schwestern mit ihren seltsamen Bräuchen, die aus dem rückständigen Russland nach Deutschland gekommen waren, ängstigten sich, dass ihre mühsam errungene Assimilation ins Wanken geraten könnte.
Die Zugewanderten hatten sich in Berlin niedergelassen, wo sie, kulturell und gesellschaftlich abgesondert von der deutsch-jüdischen Öffentlichkeit, das Scheunenviertel bewohnten. Derartige Wohnbezirke erinnerten an ein polnisch-russisches Schtetl. Das Scheunenviertel besaß das Gepräge einer ostjüdischen Enklave im emanzipierten Deutschland. Von den deutschen Juden hoben sich die Ostjuden vor allem in ihrer beruflichen und sozialen Schichtung ab. Sie vergrößerten insbesondere den quantitativen Anteil der Juden an proletarischen bzw. handarbeitenden Berufen. Aus ihren Kreisen rekrutierten sich Personen, die für den religiösen Dienst in den Gemeinden benötigt wurden: Rabbiner, Lehrer, Schächter, Kantoren, Thoraschreiber, Gebetsmäntelhersteller, Wachslichterzeuger, hebräische Schriftsetzer,–Menschen, für die Joseph Roth den trefflichen Begriff „konfessionelle Proletarier“ fand. Kurzum: Im Berliner Scheunenviertel lebten die kleijne Leijt.
Ihr Leben war gekennzeichnet durch einen unsicheren staatsbürgerlichen Status, Wohnungsnot, politische Rechtlosigkeit und vielfältige Bedrohungen durch Staat–und den Antisemiten. Kurz: Die Scheunenviertel-Juden fielen als Juden auf. Für die Westjuden verkörperten die Ostjuden das, wovon man sich entfernen und woran man nicht erinnert werden wollte – an die jüdische „Vergangenheit“.
Pogromartige Plünderungen
Das Klima war bereitet, als sich am Vormittag des 5. November 1923 an verschiedenen Stellen der Stadt Berlin eine Erregung in der Bevölkerung über die enorme Brotpreiserhöhung in Krawallen Luft machte. Die „Vossische Zeitung“ berichtete in ihrer Abendausgabe, dass es um die Mittagszeit dieses Tages zu außerordentlich ernsten Szenen gekommen sei, als jugendliche Arbeitslose zunächst vor dem Arbeitsnachweis demonstrierten und dann systematisch anfingen, die in der Münz- und Grenadierstraße befindlichen jüdischen Geschäfte zu plündern. Firmenschilder wurden abgerissen, Fensterscheiben eingeschlagen und die Geschäftsinhaber bedroht, ihre Waren herzugeben. Ein Auto wurde angehalten, der Fahrer aus dem Wagen gezerrt, dann verprügelt und das Auto demoliert. Der Mob wütete, kein Polizeibeamter war zu sehen. Das „Berliner Tageblatt“ schrieb von Szenen, die „manche Vorkommnisse des zaristischen Russlands in den Schatten“ gestellt hätten. Das Mittelalter feierte fröhliche Urständ.
Tags darauf war in der Presse davon die Rede, dass die Plünderer völkische Agitatoren gewesen seien. Die „Vossische Zeitung“ fand in ihrem Artikel „Krawalle im Berliner Zentrum. Antisemitische Ausschreitungen“ deutliche Worte: „Was man im Deutschland vor dem Kriege für völlig unmöglich gehalten hatte, was unter der planmäßigen antisemitischen Hetze seit 1918 langsam vorbereitet und in kleineren Orten, auch außerhalb des Hitlerschen Machtbereiches, schon hier und da zum Ausbruch gekommen war, das ist gestern nun auch in der Reichshauptstadt Wirklichkeit geworden: Die Plünderungen im Scheunenviertel haben sich als ernster herausgestellt als es zuerst schien; sie nahmen ganz offensichtlich pogromartigen Charakter an“.
Nach und nach wurde deutlicher, was die Ausschreitungen ausgelöst hatte. Vor dem Berliner Arbeitsamt hatten sich Zehntausende Erwerbslose gestaut, weil es geheißen hatte, dass das Amt Unterstützungsgelder auszahlen würde. Dann kam die Nachricht, es sei kein Geld mehr vorhanden und sofort breitete sich eine tumultuarische Erregung aus. „Gewerbsmäßige Agitatoren“ begannen „herumzuerzählen“, dass die in der Münz-, Dragoner- und Grenadierstraße ansässigen „Gallizier“ das von der Stadt zur Erwerbslosenfürsorge herausgegebene wertbeständige Notgeld planmäßig aufgekauft hätten. Diese Hetzreden fielen auf fruchtbaren Boden und nicht bald darauf begannen dann Plünderungen jüdischer Geschäfte und Wohnungen. Die Bewohner konnten gar keine Schutzmaßnahmen mehr treffen. Die Plünderer drangen in die Läden und Zimmer ein, prügelten auf die Bewohner ein, rissen ihnen die Kleider vom Leib – ein systematisches Treiben von Haus zu Haus, das zunächst so lange dauerte, bis erstmals nach etwa einer Stunde die Polizei am Tatort erschien und eine weitere Stunde verstrich, ehe sie den Tatort absperrte. Er gibt Berichte, wonach es aus der zusammengeströmten Menge Rufe gab, von den Plünderungen abzulassen, was allerdings unerhört blieb.
Gewalt unter den Augen der Polizei
Die Schupos schützten freilich zunächst nicht die Opfer, von der Staatsmacht hatten die Juden keine wirksame Hilfe zu erwarten. Unter den Augen der Schutzpolizei setzte sich die Gewaltorgie fort: Jede auf der Straße gehende vermeintlich jüdisch aussehende Person wurde von der schreienden Menge umringt, zu Boden geschlagen und seiner Kleider beraubt. Ein besonders krasser Fall spielte sich in der Münzstraße ab, wo man einen jungen Juden verfolgte, ihn bis aufs Hemd auszog und „halbtot“ schlug. Er wurde schließlich in Schutzhaft genommen und aufs Polizeipräsidium transportiert.
Die Polizei hatte inzwischen Verstärkungen herangeführt und Absperrungsmaßnahmen eingeleitet. Indes gingen die Ausschreitungen weiter. Viele Juden wurden von der Menge schwer misshandelt. Dann fiel ein Schuss. Ein Nichtjude wurde tödlich getroffen. Der Mob ging davon aus, dass ein Mitglied des „Reichsbunds jüdischer Frontsoldaten“ (RjF), der zur Hilfe geeilt war, den Schuss abgefeuert habe. Ein hilfeleistender jüdischer Arzt sagte aus, der Schuss sei das Signal für die Menge gewesen, „erneut über uns herzufallen“. Und ergänzte: „Wir wehrten uns, so gut es ging …“ Der Arzt war Dr. Hugo Bernhard. Er war nicht – oder nicht nur – als Arzt an den Ort des Geschehens geeilt, sondern Anführer einer jüdischen Selbstschutzgruppe, aufgestellt vom „Reichsbund jüdischer Frontsoldaten“. Allein ihre Anwesenheit, so Karsten Krampitz, dürfte das Allerschlimmste verhindert haben.
Die Rolle der Berliner Polizei, die keinerlei Hehl aus ihrer Sympathie für die Pogromisten machte, war beschämend, wie Hugo Bernhard der „Vossischen Zeitung“ zu Protokoll gab. Danach schritten Schupo-Mannschaften unter dauernden Misshandlungen schwerster Art zur Verhaftung von Juden. 500 Sicherheitswehrleute mit Karabiner und Seitengewehr machten 700 Juden zu Gefangenen. Bernhard: „In der Kaserne in der Alexanderstraße auf dem Hofe mussten wir inmitten von 200 Schupobeamten mit erhobenen Händen Aufstellung nehmen und wurden wiederum schwer misshandelt. Mir selbst ist der Mittelhandknochen der rechten Hand zerbrochen worden. Ich habe vier Jahre an der Front als Arzt mitgemacht, bin Schwerverwunderter, bin im Besitz des Eisernen Kreuzes II. und I. Klasse und des Sächsischen Ritterordens. Die Zustände machten auf mich nicht den Eindruck, als ob ich mich in einem Rechtsstaat befände“. Ein Polizeisprecher wies die Bernharsche Aussage zurück, dass er eine „antisemitische Einstellung der Schutzpolizei“ sowohl bei den Mannschaften wie im Offizierskorps für „vollkommen ausgeschlossen“ halte und versprach, den Fall des Arztes „aufs Strengste“ untersuchen zu lassen.
Die 2. Strafkammer des Landgerichts I in Berlin, die im Juni 1925 in der Berufung über die Misshandlungen seitens der Polizei verhandelte, sah das anders. Angeklagt waren fünf Schutzpolizisten. Im Laufe der Verhandlung stellte sich heraus, dass die Polizei auf die dringende Bitte der jüdischen Verteidiger, ihnen Schutz zu gewähren, diesen Hilferuf ignoriert hätte. Unter Hurra-Rufen der Menge sei der Mannschaftswagen der Polizei, ohne Hilfsmaßnahmen einzuleiten, davongefahren. Für den Mob das Zeichen, von neuem gegen die Leute des „Reichsbundes“ vorzugehen. Aus dem Gewühl der anschließenden Schlägerei fiel der erwähnte Schuss, der einen Arbeiter tötete, was die Lage weiter eskalierte. Rufe wurden laut, die Juden hätten geschossen, worauf die Polizei die Mitglieder des „Reichsbundes“ entwaffnete und auf einem Polizeiwagen verlud. In den Gerichtsakten heißt es, ein angeklagter Polizeibeamter sei mit einem Gummiknüppel in der Hand um die angetreten Mitlieder des „Reichsbundes jüdischen Frontsoldaten“ herumgegangen und habe gebrüllt: „Euch Judenjungens werden wir das [sic!] zeigen“.
Augenzeugenberichte
Es sind zahlreiche Augenzeugenberichte über die Ereignisse des 5. November 1923 überliefert. Alfred Berger, Leiter des jüdischen Arbeiterfürsorgeamtes, hat den Pogrom aus nächster Nähe miterlebt und in mehr als zehn Fällen beobachtet, dass unter den Plünderern sich immer ein oder zwei „gut gekleidete“ Agitatoren befunden und durch Rufe und Reden die allgemeine Stimmung immer wieder gegen die Juden aufgebracht und die Plünderungen dirigiert hätten. In den meisten Fällen seien diese Aufwiegler nach einer Liste auf die geschlossenen Geschäfte losgegangen und hätten die Schlösser gewaltsam aufgebrochen.
Dass es auf jüdischer Seite keine Todesopfer zu beklagen gab, obwohl Tausende Plünderer mit Rufen wie „Schlagt die Juden tot!“ durch das Viertel zogen, ist glücklichen oder zufälligen Umständen zu verdanken. Indes vermeldete die zionistische „Jüdische Rundschau“ ein Todesopfer: „Der Schlächtermeister Silberberg, der ebenso wie sein Schwiegersohn schwer misshandelt und verletzt wurde, als er einen in seinen Laden flüchtigen Verfolgten schützte, ist seinen Verletzungen erlegen“. Ob die Meldung über den Tod Silberbergs zutreffend ist, konnte nie geklärt werden.
Berger stellte heraus, dass die Opfer kleine Kaufleute und Ende des 19. Jahrhundert nach Deutschland eingewandert waren. Sie betrieben meistens einen Handel in Konfektion, Kurz- und Schuhwaren im kleinsten Umfang. Mehrere der Geplünderten waren Handwerker, eine Anzahl Arbeiter, kurz: Unter den Geschädigten befanden sich nur Arme, zum Teil sogar völlig verarmte Juden, den man den Rest ihrer Habe genommen oder vernichtet hatte.
Zur Zielscheibe der volksverhetzenden Agitation wurden die bereits in Deutschland ansässigen und im Zuge der Verfolgungen in Osteuropa zugewanderten Ostjuden. Doch nicht sie allein waren den übelsten Hetzkampagnen ausgesetzt–die Antisemiten meinten, was im Übrigen die meisten assimilierten deutschen Juden nicht erkennen wollten oder konnten, die Juden schlechthin. Umso bemerkenswerter, dass Juden – Gruppen des „Reichsbunds jüdischer Frontsoldaten“–sich im Scheunenviertel mutig und wehrhaft den Pogromisten entgegengestellt haben.
1923 war ein Menetekel
Die Burgfriedenspolitik vom August 1914 hatte nicht zum Abbau des antijüdischen Vorurteils geführt, sondern unter dem Eindruck eines allzu langen dauernden Krieges war der Antisemitismus umso heftiger aufgebrochen. Mit der „Judenzählung“ von 1916, der Sperrung der östlichen Grenzen zur Verhinderung einer ostjüdischen Zuwanderung, der Verweigerung der Einbürgerung, Internierung von Ostjuden in–schon 1920 so bezeichneten–Konzentrationslagern–wurden antisemitische Forderungen in staatliche Politik umgesetzt.
Die „Jüdische Rundschau“ brachte es auf den Punkt, wenn sie hellsichtig bemerkte, man solle mit dem Gedanken eines Pogroms in Deutschland nicht spielen. Die Folgen könnten unabsehbar sein. Berlin 1923 war ein Menetekel und zugleich ein Indiz für eine latente Bereitschaft, die künftigen unheilvollen Ereignisse zu akzeptieren. In diesem Punkt waren sich staatliche Organe bereits viele Jahre, bevor die Nationalsozialisten die Macht ergriffen, in ihrer überwältigenden Mehrheit einig–in der Abneigung gegen alles (Ost-)Jüdische. Die Bürokraten des vielen verhassten demokratischen Staates von Weimar–und zwar quer durch alle Verwaltungsebenen–haben Grundlagen für eine Politik gelegt und diese abgestützt, die vieles–rational nicht zu erklärende–möglicher gemacht hat. Die bürokratischen Träger der ersten deutschen Republik waren insgesamt nicht demokratisch ausreichend genug gefestigt, um dem Vernichtungsantisemitismus Widerstand entgegenzusetzen, ja, unterstützten ihn in gewissem Sinne.
Die sogenannte „Ostjudenfrage“ war eines der beherrschenden innenpolitischen Themen in den Anfangsjahren der Weimarer Republik, die sich in der veröffentlichten und öffentlichen Meinung und in den parlamentarischen Debatten und damit im allgemeinen Bewusstsein längst niedergeschlagen hatte. Es mag auch sein, dass die assimilierten deutschen Juden die wirkliche Gefahr, die sich in der Ostjudenhetze artikulierte und die sie keineswegs auf sich selbst bezogen, unterschätzten.
Karsten Krampitz Fazit lautet: An jenem 5. November 1923 ging die antijüdische Gewalt im Scheunenviertel auch vom Staat aus. Es war der Pogrom vor dem Pogrom. Die Weimarer Republik, die nie „goldene“ Jahre hatte, hat es in Wirklichkeit nie gegeben. Fünfzehn Jahre später, am 9./10. November 1938 wurde staatlicherseits der Ernstfall inszeniert – im Novemberpogrom. Der Scheunenviertel-Pogrom lieferte dazu die Blaupause, war im Heineschen Sinne „ein Vorspiel nur“. Schon am 4. April 1933 waren die neuerlichen Plünderungen in der Grenadierstraße vom Staat selbst organisiert.
Die Gewaltausbrüche am 5. November 1923 in Deutschlands Hauptstadt, die sich vier Tage bevor Hitler im Münchner Bürgerbräukeller auf einen Stuhl gestiegen war, mit seiner Pistole in die Decke geschossen und die „nationale Revolution“ ausgerufen hatte, ereigneten, mögen in ihrer Methodik an ähnliche Ausschreitungen im Mittelalter erinnern, in ihrer antisemitischen Stoßrichtung werfen sie jedoch deutliche Schatten weit in die Gegenwart und man mag sich fragen, wie nah uns völkisch-identitäre Agitatoren inzwischen auf die Pelle gerückt sind.
In der Gegenwart ist von den Häusern des jüdischen Scheunenviertels in Berlin wenig geblieben – und noch weniger von seinen ehemaligen Bewohnern. Die wurden nach 1933 nach und nach vertrieben, deportiert und dann ermordet.
Karsten Krampitz: Pogrom im Scheunenviertel. Antisemitismus in der Weimarer Republik und die Berliner Ausschreitungen 1923, Verbrecher Verlag Berlin 1923, 151 S., 19 Euro
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung