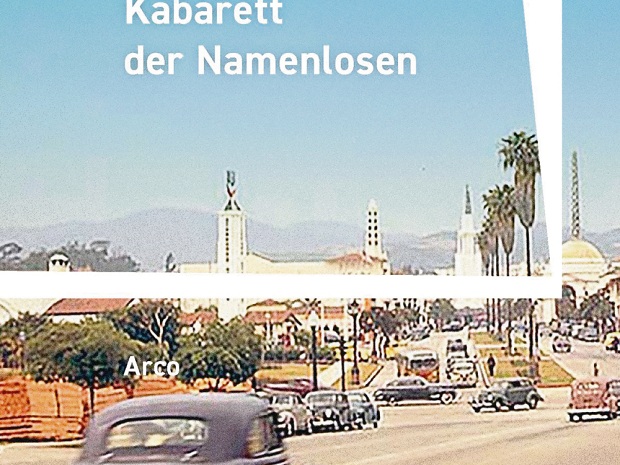Jüdisches Leben in der „DDR“ – Eine Ausstellung

Menora des Jüdischen Kulturvereins Berlin, ca. 1975–1989, VEB Wohnraumleuchten Berlin; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung Jüdischer Kulturverein Berlin e.V., Foto: Roman März
Über das Leben jüdischer Menschen in der „DDR“ ist wegen der Omertà-Politik des SED-Führungskaders eigentlich nur wenig bekannt. Die „DDR“ verfolgte eine anti-israelische Politik, unterhielt beste Beziehungen zu den arabischen Terror-Organisationen und beherbergte sogar weltweit gesuchte Terroristen. Das Jüdische Museum Berlin zeigt nun in der Ausstellung „Ein anderes Land – jüdisch in der DDR“ etwa 220 Exponate. Darunter auch eine Menora aus „DDR“-Produktion. (JR)
Dass es so etwas gab, überrascht: eine Menora aus DDR-Produktion, hergestellt vom VEB Wohnraumleuchten Berlin. Ein Exemplar ist nun im Jüdischen Museum Berlin in der Ausstellung „Ein anderes Land – jüdisch in der DDR“ zu sehen, gemeinsam mit etwa 220 anderen Exponaten.
Inzwischen ist viel über die DDR geschrieben und debattiert worden, fragt man allerdings nach dem jüdischen Leben dort, wird es plötzlich still. Keiner weiß was. Dass es Juden in der DDR gab, verrät die Prominenz des Staates: Anna Seghers, Hanns Eisler, Stefan Heym und Thomas Brasch sind nur einige von ihnen. Wie sich das Leben der Juden dort gestaltete, ist kaum bekannt. Um etwas ans Licht zu bringen, führte 1983/84 die Kanadierin Robin Ostow Gespräche mit Juden in der DDR. 12 davon kamen 1988 zur Veröffentlichung. Die darauf folgenden Bücher beziehen sich ebenfalls auf individuelle Erfahrungen von Zeitzeugen, darunter Vincent von Wroblewskys „Zwischen Thora und Trabant: Juden in der DDR“ (1993), Cilly Kugelmanns „So einfach war das: Jüdische Kindheit und Jugend in Deutschland seit 1945” (2002) und kürzlich Lara Dämmig und Sandra Anusiewicz-Baers „Jung und jüdisch in der DDR“ (2021). In den letzten Jahren sind zudem vermehrt Texte erschienen, die die Situation der Juden in der DDR in einen historischen Kontext betten.
Entsprechend groß sind nun die Erwartungen an die Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin. Wie die Autoren vor ihnen, wenden sich auch die Kuratorinnen Tamar Lewinsky, Martina Lüdicke und Theresia Ziehe an Zeitzeugen. Jedoch wird weniger ihre Geschichte erzählt, als die – wenn überhaupt – eines Objekts, das sie zur Ausstellung beigetragen haben. Diese finden sich dann in einer der acht Themenfelder wieder, die die Schau präsentiert, darunter „Zwischenzeiten“, „Ostberlin“, „Gemeinden“ und „Staatsfragen“. Im Abschnitt „Ostberlin“ gibt es viele spannende Erinnerungsstücke aus dem jüdischen Leben dort. Aber ihre Bedeutung im Zusammenhang mit der DDR; für welche Erfahrung sie stehen, bleibt die Ausstellung dem Besucher schuldig. Er muss sich selber etwas zusammen reimen.
Objekte erzählen Geschichte
Da sind die roten Stofffähnchen, die Hermann Simons Mutter zu Simchat Tora in 1950er Jahren genäht hat. Sie zeugen davon, dass improvisiert werden musste – allerdings nicht nur im jüdischen Umfeld. In der DDR herrschte insgesamt ein Mangel an diversen Alltagsgegenständen, so dass vieles selbst gemacht werden musste. Umso erstaunlicher ist eben die Menora aus DDR-Produktion. Sie stammt aus den 1970er Jahren, als es dem Staat wirtschaftlich etwas besser ging. Natürlich war die Anzahl dieser speziellen ‚Wohnraumleuchte’ begrenzt und es konnte sich glücklich wähnen, wer noch eine erwischte.
Ein Davidstern war in der DDR auch nicht erhältlich. Cathy Gelbin hat ihren der Ausstellung geliehen und erklärt: „Meine Mutter ist zu einem Juwelier gegangen und hat gefragt, ob er ihr Silber einschmelzen würde, um einen Davidstern daraus zu machen. Der Juwelier hat Angst bekommen und abgelehnt. Freunde aus Westberlin haben dann eine Kette mit Davidstern mitgebracht. An meiner neuen Schule trug ich die Kette immer. Ich wurde angehalten und gefragt, was sie bedeutet und warum ich sie trage.“
Der unbedarfte Besucher mag fragen: Warum hat der Juwelier Angst bekommen? Hinweise finden sich, wenn man einen von oben herabhängenden Kopfhörer aufsetzt und Gelbins weiteren Erlebnissen folgt. Ein Lehrer wollte den Beweggrund für den Kettenanhänger wissen und Gelbin vermutet, „dass er hauptsächlich herausfinden musste, ob das jetzt ein zionistisches Bekenntnis ist.” In „Staatsfragen“, fast am Ende der Ausstellung, erfährt der Besucher weiter, warum dies relevant war: Die DDR verfolgte eine Anti-Israel-Politik. Die Ursache dafür bleibt abermals verborgen. Es hatte nichts mit der Religion der Bewohner Israels zu tun, sondern mit der politischen Ausrichtung des Landes und dessen Verbindung zu den Vereinigten Staaten, die mit ihrer Demokratie konträr zur Ideologie des Sozialismus der DDR stand. Interessant wäre gewesen, gleichzeitig die ungeahnte Nähe zwischen der DDR und Israel herauszuarbeiten, schließlich sind Kibbuze auch vom kommunistischen Ideal geprägt.
Die ausgesparte Kontextualisierung begründen die Ausstellungsmacher mit dem Anliegen: die Objekte sollen für sich sprechen und der Besucher solle seine eigene Meinung formen. Aber ist es nicht gerade Aufgabe solch einer Einrichtung, Informationen in einen Kontext zu stellen und zu vermitteln? Gerade bei einem Thema, zu dem nicht viel bekannt ist? Gerade bei der DDR, die von immens komplexen Strukturen und Ambivalenzen geprägt war und eine differenzierte Sichtweise erfordert?
Jüdisches Leben im Sozialismus
Die differenzierte Sichtweise erhoffen sich die Ausstellungsmacher von den vielen ‚Stimmen und Erfahrungen’ der Juden. In „Zwischenzeiten“ wird die Ausgangssituation grob skizziert. Die Juden, die sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands befinden, haben im Versteck überlebt oder kehren aus Konzentrationslagern zurück. Eine andere Gruppe machen die Remigranten aus, die sich nach dem Exil bewusst für das sowjetisch-sozialistisch ausgerichtete Deutschland entscheiden. Sie sind meist Kommunisten und möchten einen neuen Staat aufbauen, der Antifaschismus groß auf seine Fahnen geschrieben hat und an eine bessere Zukunft glauben lässt. Darunter Anna Seghers und die Malerin Lea Grundig, die in dem Abschnitt kurz portraitiert werden. Ihre jüdische Identität besteht nur auf dem Papier.
Von den anfangs 3500 Juden in der Nachkriegszeit, geht nur ein Bruchteil in die Synagoge. Am Ende zählt die jüdische Gemeinde noch 400 Mitglieder, verteilt auf die acht Gemeinden im Land: Ostberlin, Schwerin, Magdeburg, Erfurt, Halle, Leipzig, Dresden und Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz). Dieser Bruchteil aber macht jüdische Identität nicht nur sichtbar, sondern erhält die Religionsgemeinschaft dort auch am Leben. Dazu gehörte Rabbi Martin Riesenburger, der in den 1960er Jahren der Ostberliner Gemeinde vorstand.
Religion war eine ambivalente Angelegenheit im Sozialismus. Religionsfreiheit stand zwar im Gesetzbuch, aber Gläubige wurden de facto beargwöhnt. Kirchengänger, beispielsweise, und all diejenigen, die sich staatlichen Organisationen wie den Jungen Pionieren, der FDJ (die ironischerweise von jüdischen Kommunisten im englischen Exil mitbegründet wurde) und der SED verweigerten, mussten mit Benachteiligungen in Ausbildung und Beruf rechnen.
Gleichzeitig gab es viele Juden der älteren Generation, die als Verfolgte des Nazi-Regimes anerkannt waren und dadurch bevorzugt behandelt wurden, wenn es darum ging, berufliche Weiterbildungen, Wohnungen und ärztliche Betreuung zu erhalten. Früherer Rentenantritt, freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, kürzere Wartezeiten auf ein Auto – zwei anstelle von 10-15 Jahren – oder andere schwer erhältliche Gegenstände wie Kühlschränke gehörten ebenso zu deren Lebensrealität. Diese teilten sie mit Kommunisten und Widerstandskämpfern, sofern sie als Verfolgte des Nazi-Regimes galten.
All dies erfährt man beim Gang durch die Ausstellung nicht. Dafür greift sie mit „Staatsfragen“ die wechselhafte Beziehung des Staates zu seinen Juden auf, die über Eckdaten illustriert wird: 1953, 1961, 1967, 1976 und 1988.
Antisemitische Welle
1953 steht für die verheerenden Auswirkungen des Antisemitismus in der Sowjetunion. Er wird in Prag mit dem Schauprozess um Rudolf Slansky international sichtbar und macht auch vor der DDR nicht halt. Viele Juden verlieren ihre Stellungen, insbesondere in der Politik, und fürchten um ihr Leben. Sie flüchten in den Westen. Andere werden unter Druck gesetzt, in die Partei einzutreten und aus der jüdischen Gemeinde auszutreten. Selbst als die Antisemitismuswelle abebbt, sitzt die Angst derart in den Knochen, dass oftmals über die jüdische Herkunft geschwiegen wird. Das Thema Antisemitismus wird über das Jahr 1953 hinaus in der Ausstellung nicht mehr angesprochen.
Während des Sechs-Tage-Kriegs 1967 im Nahen Osten verlangt die DDR von Juden, sich öffentlich gegen Israel zu bekennen. Die meisten lehnen dies ab.
Als die DDR Ende der 1980er Jahre erkennen muss, dass ihre Politik den Staat völlig destabilisiert hat, ändert sie ihren politischen Kurs. Sie blickt in Richtung USA und wendet sich der jüdischen Gemeinde zu. Sie hofft mit einer groß aufbereiteten Unterstützung derselben, d.h. der Instandsetzung der Reste der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße, die jüdische Lobby in Amerika zu mobilisieren, um Gelder fließen zu lassen. Es war zu spät. Die DDR bricht 1989 zusammen. Aber das Projekt, der Synagoge neuen Glanz zu verleihen, bleibt bestehen und wird 1995 mit der Eröffnung des Centrum Judaicums vollendet.
Ein Ausstellungsraum zeigt eine Fotoserie der damaligen Ruine, die Mathias Brauner 1987 machte. Sie dokumentiert, wie Wind und Wetter sie verfallen ließen und Bäumchen friedlich darin gediehen. Brauner war nicht der einzige Fotograf. Günter Krawutschke begibt sich ein Jahr später mit seiner Kamera auf das Gelände und verfolgt bis 1995, wie aus den Resten der Ruine ein Museum wird. Seine Reportage ist derzeit in der Ausstellung „Zeiten des Umbruchs” vor Ort im Centrum Judaicum zu sehen.
Brauners Bilder sind also keine, die man ähnlich nicht woanders schon gesehen hätte. Zumal der verwahrloste Zustand der Synagoge über Jahrzehnte hinweg zu beobachten war, da die Synagoge direkt an der Straße liegt und für jedermann sichtbar.
Spannender wäre gewesen eine Gegenüberstellung mit der Synagoge in der Rykestraße. Die dürfte Besuchern von außerhalb weniger bekannt sein, besticht aber durch ihre außergewöhnliche Schönheit und war ein zentraler Ort, wo sich das Ostberliner Gemeindeleben abspielte.
Ein anderer Ort, der ein kleines Fenster in die jüdische Lebenswelt der DDR bot, war die koschere Fleischerei im Prenzlauer Berg. Die Ausstellung zeigt ein Foto derselben zusammen mit einem Bezugsschein von 1958 sowie dem Stempel „Kóser“. Er gehörte Károly Timár, der in den 1980er Jahren regelmäßig aus Ungarn anreiste, um koscheres Fleisch zu ermöglichen. Auch darin offenbaren sich die unterschiedlichen Seiten der DDR: Einerseits die erwähnte Mangelwirtschaft, andererseits das Bemühen, etwas religiöses Leben zu ermöglichen. Aber darauf gehen die Ausstellungsmacher nicht ein – lediglich, dass sie – als einzige koschere Fleischerei im Land – auch von Vertretern der muslimischen Botschaften genutzt wurde.
Unterstützung aus dem Ausland
Károly Timár war nicht der einzige, der aus dem Ausland angereist kam, um der jüdischen Gemeinde zur Seite zu stehen. Nachdem Martin Riesenburger 1965 starb, wurden Rabbiner aus dem Ausland geholt, um zumindest die hohen Feiertage würdig begehen zu können. Ohne religiöse Kompetenz im Land, blieb die religiöse Erziehung des Nachwuchses auf der Strecke. Erst als Peter Kirchner in den 1970er Jahren der Vorstand übernahm, regte er die Gründung einer Kinder- und einer Jugendgruppe an. Regelmäßig aus Berlins Westen kamen die Kantoren Estrongo Nachama und Leo Roth. Sie sangen nicht nur – die Synagoge in der Rykestraße hatte mit Oljean Ingster ihren eigenen Kantor - sondern brachten mitunter auch fehlender Gebetsbücher. Sie bildeten insofern einen Teil des jüdischen Lebens in der DDR, als dass sie in der monatlichen Sabbatfeier im Berliner Rundfunk sangen und mit dem Leipziger Synagogalchor auftraten.
Etwas unvermittelt, und daher im Rahmen der Ausstellung etwas zusammenhangslos erscheinend, aber dennoch eine Facette der jüdischen Präsenz in der DDR hervorkehrend, bildet der Raum „Film und Fernsehen“. Darin flimmern Ausschnitte aus 23 Spiel- und Fernsehfilmen über eine Leinwand, darunter Konrad Wolfs „Professor Mamlock“ und „Sterne“ sowie Frank Beyers „Jakob, der Lügner“. Bedauerlich ist hier, dass keine Dokumentarfilme vertreten sind. Insbesondere Róza Berger-Fiedlers „Erinnern heißt leben“ von 1988 würde interessante Einblicke in die damalige Welt geben. Die Filmemacherin zeichnet die Geschichte der Juden Berlins nach und nimmt Bezug zur Gegenwart. So ist auch der Chanukkah-Ball im Café Moskau zu sehen.
In Form einer Einladungskarte ist dieser ebenfalls in der Ausstellung präsent. Allerdings könnte für Außenstehende mehr geboten werden als die bloße Objektbeschreibung „Einladung zum Chanukka-Ball im Tanzcafé Moskau Berlin, 1975“. Das Café bzw. Restaurant Moskau war ein Prestigeobjekt der DDR und dort zu feiern, war etwas Besonderes. Darüber hinaus war der Channukka-Ball nicht nur bei Juden beliebt – auch Nicht-Juden waren dankbar, wenn sie noch eine Karte ergatterten. Der Ball hatte Tradition.
Zugegeben die Ausstellung hat nicht den Anspruch, speziell ‚jüdisches Leben’ in der DDR zu zeigen, schließlich lautet der Untertitel weise „jüdisch in der DDR“ und kann damit sämtliches umfassen, was in irgendeiner Form mit dem Judentum in Verbindung steht.
Trotz aller Mängel, ist es doch ein Verdienst des Museums, Relikte der jüdischen Präsenz in der DDR zusammenzutragen und zu bewahren, so dass in Zukunft vielleicht eine neue Ausstellung zu dem Thema gestaltet werden kann – eine, die sehr viel tiefer geht und ein klareres, zusammenhängendes Bild jüdischen Lebens in der DDR schafft, bei dem auch der Kontext zum DDR-Staat sowie seinen Nachbarländern in Ost und West besser verständlich wird. Bis dahin bleibt die Menora vom VEB Wohnraumleuchten Berlin ein Lichtblick.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung