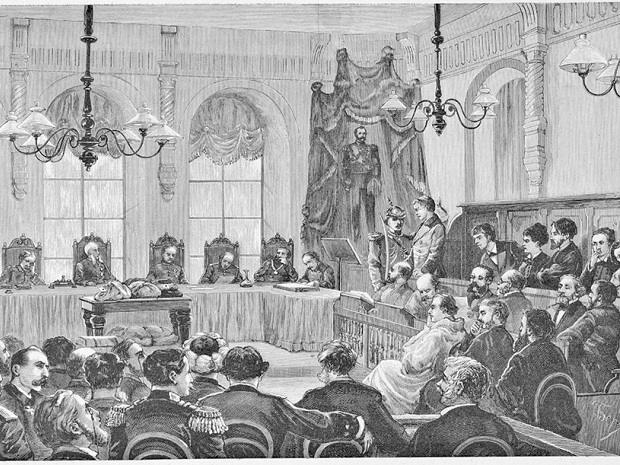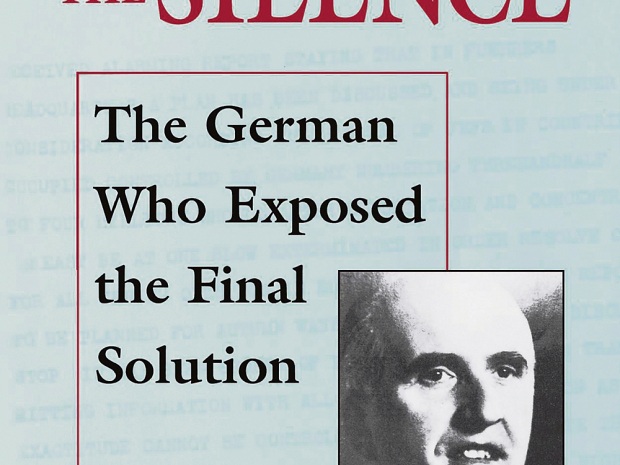Olympia-Attentat 1972 – „The games must go on“

Bei den Olympischen Spielen 1972 ermordeten arabische Terroristen elf Mitglieder des israelischen Teams.© HANDOUT IPPA AFP
Am 5. September 1972 haben arabische Terroristen des sogenannten „Schwarzen September“ das Quartier der israelischen Mannschaft überfallen, Olympioniken und Trainer als Geiseln genommen und bis zum Ende der desaströsen Befreiungsaktion 11 Israelis und einen deutschen Polizisten ermordet. Den barbarischen Terrorakt bejubelte die inhaftierte RAF-Terroristin Ulrike Meinhof damals als eine „großartige revolutionäre Tat“. Während in Deutschland nur 27 Jahre nach Kriegsende wieder Juden ermordet wurden und Israel seine gefallenen Athleten zu Grabe trug, feierte der offene linke Antisemitismus Urstände und die Bunderepublik Deutschland, der Freistaat Bayern und das Olympia-Komitee ließen die Olympischen Spiele weiterlaufen als sei nichts geschehen. (JR)
Es sollten erklärtermaßen „heitere“ Olympische Spiele werden, in München, 1972. Nach der großen NS-Propaganda-Schau von 1936 war Deutschland zum zweiten Mal Ausrichter der Olympischen Sommerspiele. Heitere Spiele, die der Welt ein neues Deutschland zeigen sollten, ein unbeschwertes, fröhliches Land, weltoffen und gastfreundlich. Popklänge von der Kurt-Edelhagen-Band statt Marschmusik, bunte Kleidung statt grauer (oder gar brauner) Uniformen, geplantes Durcheinander statt sturer deutscher Disziplin - ohne aber die für ein solches Ereignis notwendigen „deutschen Tugenden“ wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu vergessen. Eben ganz anders.
Das Stadiongelände mit dem markanten Zeltdach, das herrliche Wetter, die glänzenden sportlichen Leistungen, ein jüdischer Megastar wie der Schwimmer Mark Spitz, der die Menschen elektrisierte, ein Publikum, das die deutschen Athleten begeistert unterstützte, aber auch die Athleten anderer Nationen anfeuerte. Doch das Unbegreifliche geschah, der jähe Einbruch brutaler Weltpolitik in die scheinbar heile Welt des Sports. Mit München 1972 hat der Sport endgültig seine Unschuld verloren. Danach war nichts mehr so wie vorher.
Das Attentat auf die israelische Mannschaft durch eine „palästinensische“ Terrorgruppe am 6. September 1972 im olympischen Dorf traf alle ziemlich unvorbereitet. Sicher, man hatte terroristische Anschläge durchgespielt, eine Entführung von Sportlern, das Kidnapping eines arabischen Prinzen - die Spannungen zwischen Israel und den „Palästinensern“ waren ja kein Geheimnis, man musste mit Terroraktionen rechnen. Und diese erfolgten. Aber es gab kein Handlungskonzept, und die Beendigung der Geiselnahme wurde ein Waterloo deutscher Polizeiarbeit. Das Drama von München lässt sich anschaulich an einer Athletin festmachen, der israelischen Weltklasse-Leichtathletin Esther Shachamorov.
Fallbeispiel: Esther Shachamorov-Roth
Zum israelischen Olympia-Team 1972 gehörte die 1952 in Tel Aviv geborene Leichtathletin Esther Shachamorov, die vor allem in den Disziplinen 100-, 200- und 100-Meter-Hürdenlauf erfolgreich war. Ihre Eltern waren 1940 von Moskau aus nach Palästina eingewandert. Im Alter von 14 Jahren wurde sie von ihrem langjährigen Förderer und Trainer Amitzur Schapira entdeckt. Bei der Achten Makkabiade 1969 in Ramat Gan gewann sie die Wettbewerbe über 100, 200 Meter und im Weitsprung. Schon als 18-Jährige zählte sie zu den weltbesten Kurzstreckenläuferinnen. Für einen Tag hielt sie den Hallenweltrekord im 60-Meter-Hürdenlauf. Über die 100-Meter-Distanz siegte sie 1970 bei den Asienspielen in Bangkok, wo sie außerdem eine Goldmedaille im Fünfkampf und eine Silbermedaille im Weitsprung errang.
Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt erst 20 Jahre alt war, wurden ihr vor den Olympischen Spielen in München von manchen Experten Außenseiterchancen auf Medaillen eingeräumt. Im Vorlauf stellte sie im 100-Meter-Lauf in 11,45 Sekunden einen neuen israelischen Rekord auf, der bis 2002 halten sollte. In der Vorschlussrunde verpasste sie sehr knapp als Fünfte ihres Laufes den Einzug ins Finale. Zwei Tage darauf, am 4. September 1972, bestätigte sie ihre gute Form und erreichte im 100-Meter-Hürdenlauf in neuer persönlicher Bestzeit das Halbfinale. Und gleichzeitig entfachte sie eine beispiellose Begeisterung in ihrer Heimat. „Viele Israelis haben sich damals extra einen Fernseher gekauft, um mich zu sehen“, erzählt sie. „Die Straßen waren leer und die Knesset unterbrach sogar ihre Sitzungen, damit die Leute meinen Wettkampf sehen konnten.“ Sie sahen, wie Shachamorov am 4. September 1972 auch in ihrer Paradedisziplin Hürdenlauf mit persönlicher Bestzeit das Halbfinale erreichte. „Ein großartiger Moment“, erinnert sie sich. „Mein Coach Amitzur fühlte sich wie auf Wolke sieben und sagte mir: ‚Das ist der glücklichste Tag in meinem Leben!‘“ Die ganze Mannschaft feierte an diesem Abend ausgelassen, besuchte gemeinsam ein Musical, trug ihre Heldin auf den Schultern. Dann, am nächsten Morgen, begann der Alptraum.
Terror im Olympiadorf
Am frühen Morgen des nächsten Tages drangen „palästinensische“ Terroristen der sogenannten Organisation „Schwarzer September“ in das Quartier der israelischen Mannschaft ein und nahmen neun Geiseln, nachdem sie den Trainer Mosche Weinberg und den Gewichtheber Josef Romano getötet hatten. Die Attentäter verlangten die Freilassung von 236 in Israel inhaftierten „Palästinensern“ sowie die Entlassung der RAF-Terroristen Ulrike Meinhof und Andreas Baader aus deutscher Haft. Esther Shachamorov wohnte 200 Meter vom Tatort entfernt in einem anderen Gebäude.
Wider Willen wurde die Rumpf-Mannschaft Augenzeuge des Geiseldramas. Sie sah im Fernsehen die Bilder von den Entführern, die sich in Strumpfmaske auf dem Balkon des besetzten Apartments zeigten. Erfuhren von den lähmenden Verhandlungen und wussten, dass sich die israelische Regierung niemals Forderungen von Terroristen beugen würde. Die Athleten waren verängstigt, gereizt, trotzig. Einige wollten am liebsten selbst zu den Waffen greifen. Und alle waren sich einig: Esther Shachamorov solle am nächsten Tag ihr Halbfinale antreten. Aus Prinzip. Um zu beweisen, dass Israel keine Angst hat.
Trotz der nagenden Ungewissheit versprach Shachamorov ihrem Teamchef, am nächsten Tag anzutreten. Der Mannschaftsarzt gab ihr zwei Schlaftabletten, noch heute erinnert sie sich an ihre Träume. Wilde Träume, in denen sie rannte, so schnell wie noch nie. Für ihren Trainer. Doch als sie am nächsten Morgen aufwachte, blickte sie in traurige Gesichter. „Ohne dass jemand nur ein Wort sprach, wusste ich sofort, dass er und alle anderen tot waren. Es war der schlimmste Tag in meinem Leben.“ Und das bis dahin schlimmste Desaster deutscher Sicherheitsbehörden.
Gescheiterter Befreiungsversuch
Der Befreiungsversuch mündete in einer stundenlangen, unkontrollierten Schießerei, an deren Ende die Terroristen die Geiseln töteten. Auch fünf der Attentäter und ein deutscher Polizist starben. Die Welt erstarrte im Schock. Die Spiele wurden unterbrochen, eine Trauerfeier abgehalten, doch dann erklärte der Präsident des Olympischen Komitees: „The games must go on!“
Doch die junge Athletin fühlte sich überfordert. Wie sollte sie in so einer Situation laufen können? Sehr bald erhielt sie die Nachricht, dass die Geiseln, unter ihnen ihr Trainer Amitzur Schapira, nach einem chaotisch durchgeführten Befreiungsversuch auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck ermordet worden waren. Sie trat zum Hürdenlauf-Wettbewerb nicht mehr an und reiste zurück nach Israel. Aufgrund der Ereignisse in München wollte Esther Shachamorov ursprünglich ihre Karriere sofort beenden. Ihr späterer Ehemann und Trainer Peter Roth führte sie jedoch wieder an den Sport heran.
Angst hatte sie zu keiner Zeit. Der Leiter der israelischen Olympiamannschaft sah die Situation hingegen realistischer. Er beschwerte sich darüber, dass einige seiner Athleten in Appartements im ersten Stock untergebracht waren. Ein paar Etagen höher wäre es doch wesentlich sicherer. Der Einwand wurde ignoriert.
Der Rückflug von München nach Tel Aviv: Am schlimmsten war für Esther Shachamorov der Gedanke, dass ihr toter Trainer nun da unten lag, im kalten Frachtraum der israelischen El-Al-Maschine, während sie hier oben saß, in einem bequemen Sitz neben den anderen Flugpassagieren. Unten die Toten. Oben die Überlebenden. Sie reisten in demselben Flugzeug nach Israel zurück.
Voller Träume waren Athletin und Trainer wenige Tage zuvor gemeinsam nach München geflogen. Jetzt kehrten sie getrennt zurück, und als die Maschine am Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv landete, versank ein ganzes Land in Trauer und Apathie. Zehntausende erwarteten die Maschine und begleiteten die Särge zu den verschiedenen Friedhöfen in ganz Israel. Elf Teilnehmer der Olympiamannschaft hatten die Entführung durch das „palästinensische“ Terrorkommando nicht überlebt. Die Toten waren zwar nicht die ersten israelischen Terroropfer im Ausland. Doch nie zuvor war Israel dermaßen paralysiert und gedemütigt worden.
Shachamorovs Startblock blieb beim Halbfinale leer. Damals konnte die Athletin die Entscheidung nicht verstehen. Empört unterstellte sie dem Komitee, die Spiele nur fortgeführt zu haben, weil Israel ein unbedeutendes Land ohne Ölvorkommen sei. Heute sieht sie das anders: „Wenn man nur einmal nachgibt, haben die Terroristen gewonnen. Dann gibt es irgendwann kein Olympia mehr.“
Ein außerordentliches Talent
Esther Shachamorov gehörte zu den Überlebenden der Geiselnahme bei den Olympischen Spielen in München 1972, die nach einer dilettantischen Befreiungsaktion in einem Blutbad geendet hatte. Für sie war es die bitterste Heimreise in ihrem Leben. Denn unter den Toten war ihr Coach Amitzur Schapira. Der Mann, der sechs Jahre zuvor ihr Talent entdeckt hatte. Der sie zur besten israelischen Leichtathletin und zu einer der schnellsten Hürdenläuferinnen der Welt gemacht hatte.
Bei der IX. Makkabiade im Jahr 1973 siegte sie auf den Kurzstrecken und im Weitsprung. Erst nach den Wettbewerben erfuhr sie, dass sie im dritten Monat schwanger war. Goldmedaillen in allen Sprintdisziplinen gewann sie auch bei den Asienspielen ein Jahr darauf in Teheran. Einen weiteren Karrierehöhepunkt stellten die Olympischen Spiele 1976 in Montreal dar. Nachdem sie sich im Halbfinale des 100-Meter-Hürdenlaufes als Vierte im Fotofinish durchgesetzt hatte, stand Esther Roth als erste Sportlerin aus Israel in einem olympischen Finale. Dort bestätigte sie ihre Zeit aus dem Halbfinallauf und wurde Sechste. Sie war damit die schnellste Hürdenläuferin außerhalb Osteuropas. Bis in die späten 1990er Jahre hinein galt diese Platzierung als bemerkenswerteste Leistung im israelischen Sport überhaupt.
Zwei Monate nach den Olympischen Spielen 1976 verbesserte sie beim ISTAF in Berlin ihre persönliche Bestzeit in der Hürdendisziplin auf 12,93 Sekunden, eine Rekordmarke, die seither in Israel nicht erreicht wurde. Es handelte sich hierbei um ihren ersten Wettkampf in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Massaker von München. Ein Jahr darauf nahm sie auch am 1. Leichtathletik-Weltcup in Düsseldorf teil. Bei den Asienspielen 1978 in Bangkok durfte sie nicht antreten, da Israel auf Druck arabischer Staaten und der Volksrepublik China aus der Asian Games Federation ausgeschlossen worden war.
Im Alter von nur 27 Jahren erklärte Esther Roth-Shachamorov 1979 ihren Rücktritt vom aktiven Sport; ein Comeback 1980 blieb von kurzer Dauer. Nachdem sie es jahrzehntelang für einen Fehler gehalten hatte, dass die Olympischen Spiele in München nach dem Anschlag auf die israelische Mannschaft fortgesetzt worden waren, bewog sie das Bombenattentat während der Olympischen Spiele 1996 in Atlanta zu einer Neubewertung der Situation. Der „Jerusalem Post“ sagte sie 1997: „Wenn Sportveranstaltungen von nationaler oder internationaler Bedeutung von Terroranschlägen oder anderen Zwischenfällen betroffen sind, gibt es keine andere Wahl, als die Veranstaltung fortzusetzen [...] Vom Unerwarteten werden wir uns ohnehin nie ganz schützen können.“
Esther Roth-Shachamorov wurde von der Zeitung „Maariw“ dreimal zu Israels Sportlerin des Jahres gekürt. 1999 erhielt sie für ihre Lebensleistung den Israel-Preis. Sie arbeitete nach ihrer Sportkarriere als Sportlehrerin an einer Schule in Kfar Saba. Die Mutter zweier Kinder lebt mit ihrem Mann in Herzliya.
Spätestens mit dem Eindringen „palästinensischer“ Terroristen in das israelische Olympiaquartier, der anschließenden Ermordung und Geiselnahme israelischer Olympioniken sowie dem Verkünden des IOC-Präsidenten, die Spiele müssten weitergehen, hatte IOC-Präsident Avery Brundage die Vergangenheit wieder eingeholt.
Avery Brundage und der Arier-Paragraph
36 Jahre zuvor, im Vorfeld der Olympischen Spiele 1936 in Berlin, war es der US-amerikanische führende Sportfunktionär Avery Brundage, der großes Verständnis für das Nationale Olympia-Komitee Deutschlands zeigte, das jüdische Sportler von den Spielen auszuschließen beabsichtigte. Mitgespielt in diesem Poker hat das amerikanische Olympia-Komitee in Person von Avery Brundage, der zunächst mit einem Olympiaboykott seitens USA gedroht hatte, wenn deutsch-jüdische Sportler an den Spielen nicht teilnehmen dürften, zugleich jedoch eine Allianz mit der NS-Sportführung zur Sicherung der Spiele von Berlin schmiedete.
Brundage war schon 1934 nach Deutschland gereist, gab vor, niemanden getroffen zu haben, der diskriminiert worden wäre. Er wollte niemanden sehen. So war es lediglich ein amerikanischer Beinahe-Boykott, denn in Wirklichkeit erwog die USA nie ernsthaft ein Fernbleiben der Spiele in Berlin. Fragen nach der Diskriminierung außerhalb des Sports waren für Brundage als Amerikaner irrelevant. Brundage, in dessen Chicagoer Club auch ein „Arierparagraph“ galt, wonach keine Juden erlaubt waren, wie er süffisant bemerkte, war ganz einverstanden mit der Judenpolitik der Nazis – als erklärter Antisemit bekannte er sich zum Grundsatz - „separate but equal“. Nach den Spielen sagte er: „Wir können viel von Deutschland lernen“. Entscheidend für ihn allein war die Frage, ob sich Juden für die Olympiamannschaft in entsprechenden Wettkämpfen qualifizieren dürften. Dies wurde ihm bestätigt; auch die Durchführung jüdischer Meisterschaften erweckte den Eindruck, als sei die Qualifikation für die gemeinsame Olympiamannschaft möglich. Doch all dies war nichts als Bigotterie: Die Amerikaner kuschten vor den Nazis und ließen ihre beiden einzigen jüdischen Athleten in der Mannschaft, Marty Glickman und Sam Stoller, auch nicht antreten.
Als ein Jahr vor der Eröffnung der Olympischen Spiele die Kampagne um den Olympiaboykott deutlich zunahm, verfasste Brundage eine massiv antisemitische Broschüre und benutzte jedes nur mögliche Argument, um die amerikanische Olympiateilnahme sicherzustellen. Wie bei seiner vorgefassten Meinung wurde hierbei deutlich, dass es ihm nicht um eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Juden in Deutschland ging, sondern allein darum, Olympische Spiele möglichst ungestört in Deutschland feiern zu können.
Die Karriere des Avery Brundage verlief weiterhin glanzvoll. Seine Indifferenz gegenüber politischen Ereignissen im Umfeld von Olympischen Spielen behielt er zeitlebens bei: Als 1972 in München elf Sportler der israelischen Olympiamannschaft Opfer „palästinensischen“ Terrors wurden, verkündete Brandage sein berühmtes Credo: „The games must go on!“ In München sah sich der amerikanische Olympia-Funktionär Brundage zum zweiten Mal mit dem Judentum konfrontiert. In Berlin 1936 waren es die deutsch- und amerikanisch-jüdischen Athleten; in München 1972 die jüdischen Sportler aus Israel.
Offener linksradikaler Antisemitismus
Und im November 1972 bejubelte Ulrike Meinhof den Anschlag des „Schwarzen September“ auf israelische Athleten bei den Olympischen Spielen in München als großartige revolutionäre Tat mit den Worten, Israel selbst habe seine Sportler „verheizt wie die Nazis die Juden – Brennmaterial für die imperialistische Ausrottungspolitik“. Das Ziel der westdeutschen Regierung sei es gewesen, so Ulrike Meinhof, „nur ja dem Mosche-Dayan-Faschismus – diesem Himmler Israels“ – in nichts „nachzustehen“. Es gab einen westdeutschen linksradikalen Antisemitismus, der offen den Mord an Juden guthieß!
Für Meinhof und mit ihr andere RAF-Komplizen war der Anschlag in München eine großartige revolutionäre Tat. Die arabischen Völker hätten begriffen, wen sie mit Westdeutschland vor sich hatten – „imperialistische Ausrottungsstrategen“. Es sei nicht die Schuld der PLO-Kämpfer gewesen, dass die israelischen Athleten zu Tode gekommen seien, es sei „idiotisch zu glauben“, die Revolutionäre hätten dies „gewollt“. Sie wollten doch nur die Freilassung der „palästinensischen“ Gefangenen bewirken. Und deswegen hätten sie Geiseln genommen von einem Volk, das ihnen gegenüber „Ausrottungspolitik“ betreibe. Die deutsche Polizei hätte die Revolutionäre und die Geiseln „massakriert“. Der Meinhofsche Appell endete in Anspielung auf Marx mit dem Slogan „Revolutionäre aller Länder vereinigt Euch!“ Mit diesem Aufruf hatte Ulrike Meinhof zu Dieter Kunzelmann und weiteren prominenten Wortführer der radikalen Linken aufgeschlossen, die rhetorische Solidarität mit den Arabern und den sogenannten „Palästinensern“ mit einem leidenschaftlichen Jubel über „palästinensische“ Gewalt gegen Israelis verflochten. Ulrike Meinhofs Schrift „Die Aktion des Schwarzen September in München: Zur Strategie des Antiimperialistischen Kampfes“, ein Essay über den Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft in München, wurde fester Bestandteil des Kanons linksextremen Antisemitismus in der deutschen und europäischen Nachkriegsgeschichte. Die Feindseligkeiten gegenüber Israel wurde nach 1967 definierendes Merkmal des westdeutschen Linksextremismus und erlebte ihren Höhepunkt in den Anschlägen gegen das israelische Olympiateam während er Olympischen Spiele in München 1972.
Gab es keine Alternative?
Im IOC hatte man sich wohl darauf verständigt, dass die gerade stattfindenden Wettkämpfe beendet, neue an diesem Tag aber nicht mehr begonnen werden sollten. Die Spiele würden unterbrochen, müssten aber weitergehen. Olympia-Pressesprecher Hans Klein, ab 1989 Bundesministers für besondere Aufgaben und Leiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung erklärte: „Es wird sich erweisen, dass die olympische Idee stärker ist als Terror und Gewalt“. Und auch er übernahm wortgleich das Brundage-Diktum, die Spiele müssten weitergehen!
Stadionsprecher Detlev Mahnert musste bei den Olympischen Spielen 1972 die Entscheidung des IOC zum Weitermachen verkünden. In der Aufregung fiel ihm das englische Wort für Geiseln nicht mehr ein. Die Fortsetzung der Olympische Spiele verkündete dann der IOC-Präsident Avery Brundage selbst mit einem Satz, der Geschichte machte und zum geflügelten Wort wurde: „The games must go on“. Mussten die Spiele tatsächlich weitergehen? Gab es keine Alternativen? Was wäre gewesen, hätte das Attentat der, sagen wir, der US-amerikanischen Mannschaft gegolten?
Das Blutbad von Fürstenfeldbruck ist mit den olympischen Spielen von München 1972 unlösbar verbunden. Im kollektiven Bewusstsein der Menschen, die in irgendeiner Weise mit Sport zu tun haben, sind diese Olympischen Spiele nicht als die „heiteren“, sondern als die blutigen gespeichert.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung