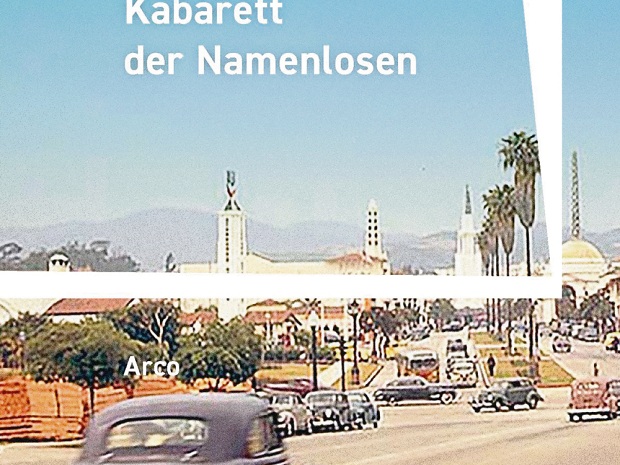„Kennen Sie einen Juden?“: Alle möglichen jüdischen Geschichten

Das Buch ist eine Hommage an jüdische Künstler, an das Schtetl, den jüdischen Witz und die jiddische Sprache, alles einzigartig, ausgestattet mit dialektischer Akrobatik und doppelten Böden. Die Journalistin und Germanistin Birgit Lahann nimmt den Leser mit in eine vergangene Zeit, voll mit Geschichten, die einem zum Lachen bringen oder die Tränen in die Augen pressen. (JR)
Der Buchtitel stammt aus einem Interview der Autorin mit dem international gefeierten Opern- und Theaterregisseur, dem Deutsch-Australier Barrie Kosky, ab 2012 Intendant der Komischen Oper in Berlin. Dieser hatte sich für eine Dokumentation über den Antisemitismus in Deutschland an das Brandenburger Tor begeben und Passanten mit der Frage konfrontiert: „Kennen Sie einen Juden? Ich bin einer. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich.“ Eine provokante Frage, gewiss, und die Antworten waren vielsagend, auch erschreckend. Er hörte zumeist ein „Nein“ oder „No“. Und irritiert fragte er sich, wo er denn „gelandet“ sei, was für ein Land ist das denn hier?
Dies ist eine von vielen weiteren Geschichten, die Birgit Lohann in ihrem Buch erzählt – kurzweilig, witzig, informativ, mal ernst, immer nachdenklich, auch anekdotenhaft und sie bewegt sich dabei ebenso feinfühlig wie kenntnisreich auf sicherem Terrain. Angesichts der Tatsache, dass die Personen, die zu Wort kommen, und die Welt, die sie beeinflusst haben, nicht mehr existiert, macht ihr Buch auch wehmütig, wenn nicht traurig. Sie erzählt turbulente Geschichten wie die von: Marc Chagall, Joseph Roth, Elisabeth Bergner, Wolf Biermann, Johannes Mario Simmer, Ignaz Bubis, Ralph Giordano, Coco Schumann und viele andere. Sie schreibt mit leichter Feder und der Leser darf sich beim Lesen immer auf die nächstfolgende Geschichte freuen.
Mit Barrie Kosky kommt Birgit Lahann auf Max Reinhardt zu sprechen und das Gespräch wird nachdenklich und anrührend: 1905 war Max Reinhardt Intendant und Eigentümer des Deutschen Theaters in Berlin, machte das Deutsche Theater zum Zentrum deutscher Theaterkunst und führte es mit diversen Gastspielen zu Weltruhm.
„Ehren-Arierschaft“
Erster März 1933: Als letzte Inszenierung Max Reinhardts am Deutschen Theater wird Hugo Hofmannsthals „Das große Welttheater“ aufgeführt. Dann fällt der Vorhang für das Ensemble. Als Propagandaminister auch für Kulturfragen zuständig bietet Joseph Goebbels Max Reinhardt eine „Ehren-Arierschaft“ an, die dieser entrüstet ablehnt. Reinhardt verlässt Deutschland.
Nach seiner Flucht aus Deutschland schreibt Reinhardt am 16. Juni 1933 an die Hitler-Regierung: „Der Entschluß, mich endgültig vom Deutschen Theater zu lösen, fällt mir naturgemäß nicht leicht. Ich verliere mit diesem Besitz nicht nur die Frucht einer 37-jährigen Tätigkeit, ich verliere vielmehr den Boden, den ich ein Leben lang gebaut habe und in dem ich selbst gewachsen bin. Ich verliere meine Heimat.“ In den USA war Max Reinhardt mittellos. Er, Reinhardt, schreibt er weiter, habe „alle Ursache“ anzunehmen, dass er mit seiner Tätigkeit dem Theater auch in schwerer Zeit hätte entscheidend helfen können. „Das neue Deutschland wünscht jedoch Angehörige der jüdischen Rasse, zu der ich mich selbstverständlich uneingeschränkt bekenne, in keiner einflussreichen Stellung.“ Am Ende seines Briefes gelingen Reinhardt Zeilen, vor denen die Nazis, die sie gelesen haben, rot hätten werden müssen: „Wenn ich nun aus den gegebenen Umständen die einzig mögliche Folgerung ziehe und dem Staat meinen Besitz überlasse, so nehme ich mit gutem Gewissen die Überzeugung mit mir, daß ich damit meine Dankesschuld abtrage für meine langen glücklichen Jahre in Deutschland“. Ob sich der hinkende Propagandaminister Joseph Goebbels beim Lesen dieser Worte geschämt hat, ist nicht überliefert. Vermutlich nicht.
„Geschichte aus dem Schtetl“
Birgit Lahann ist Germanistin und Theaterwissenschaftlerin, die mit Peter Zadek zusammengearbeitet hat und 25 Jahr Autorin beim „Stern“ war. Sie ist hoch dekoriert mit den angesehenen Theodor-Wolff und Egon-Erwin-Kisch-Preis. So wie Barrie Kosky hat die Journalistin Birgit Lahann viele weitere jüdische Prominente getroffen und sich ausgetauscht, hat Geschichten über längst Verstorbene zusammengetragen.
Birgit Lahann benötigt keine Vorrede und kein Nachwort, auch keinen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat oder ein Literaturverzeichnis. Von der ersten Seite an ist sie mittenmang in ihren Geschichten, die im ersten Teil mit den Beteiligten Isaac Bashevis Singer, Manés Sperber, Marc Chagall, Alexander Granach oder Scholem Alejchem in den Hauptrollen im osteuropäischen Schtetl spielen. Sie alle kamen aus der chassidischen Welt des Schtetl, verkörperten sie. Es folgen Geschichten vom Juden Shylock, weiter geht es bei ihr mit Personen, die mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels im Jahre 1998 und dem Preisträger Marin Walser zu tun haben, um mit Geschichten zwischen „Gips & Marmor, Brecht & Heine, Muppet-Show & Kafka“ zu enden.
In ihrer ersten „Geschichte aus dem Schtetl“ schildert Lahann eine wundersame Geschichte des Isaac Bashevis Singer in Anlehnung eines seiner schönsten Bücher „Mein Vater der Rabbi“. Singer, der einzige Jiddisch schreibende Literaturnobelpreisträger (1978), schrieb viel über das Schtetl und die in ihm wohnenden Menschen. Das jüdische „Städtchen“ in Osteuropa war doch viel mehr: Es war Gemütszustand, eine Geisteshaltung, ein Glaubensbekenntnis, beschreibt Birgit Lahann diesen Raum, eben jener elende Traum, in dem Mangel, Hunger und Armut ertragen wurden, weil der Himmel über jedem Schtetl aufgespannt war. Das Schtetl war ein einzigartiger – leider vernichteter – Kosmos, der in Marc Chagalls Bildern weiterlebt. Bilder, in denen Esel auf Dächern zu sehen sind, wo Liebespaare durch die Luft schweben, jeder physikalischen Logik widersprechen. Das Schtetl war das Treibhaus für Künstler und Schnorrer, die mit Luft oder Eier handelten, die noch nicht gelegt waren. Es waren, wie der kluge, tiefsinnige Manés Sperber sie genannt hat, die „Wasserträger Gottes“. Das Schtetl war nicht nur ein Zufluchtsplatz für eine verfolgte Minderheit, sondern ebenso ein großes Versuchslaboratorium für Friede, Selbstbeherrschung, Humanismus - und Witz. Der jüdische Witz und die jiddische Sprache, einzigartig beides, ausgestattet mit dialektischer Akrobatik und doppelten Böden.
Der Schriftsteller und Philosoph Sperber war es, der im Schtetl Zablotów groß geworden ist, der davon berichtete, dass sein Urgroßvater jeden Tag bei Anbruch des Abends aus dem Haus eilte, mit wehendem Kaftan einen Hügel hinauflief, um ja nicht die Ankunft des Messias zu verpassen.
Die „Mischpoche ist auf Maloche“
Im Schtetl wurde Jiddisch gesprochen. Eine Sprache, vom Ursprung her das mittelhochdeutsch, das die Juden vor Jahrhunderten mit ins Ghetto hinein- und dann, als die Ghettomauern fielen, unverfälscht als „stehen gebliebenes“ Deutsch wieder mit hinausgenommen haben. Im Schtetl „schlürfte und schmatzte“ man diese Sprache und sprach sie mit Händen und Armen. Lahann zitiert dazu diesen makabren Witz: Einmal soll ein Jude bei einem Unfall beide Arme verloren haben. Da fragte man entsetzt: Und womit redet er jetzt?
Über das Jiddische und ihre Spuren im Deutschen an sich fällt Lahann Folgendes ein: Die Mischpoche ist auf Maloche, steht Schmiere, redet Tacheles und macht mit Chuzpe den Reibach, bevor der Pleitegeier kommt, der Schlamassel, der die Schickse in den Knast bringt, wo sie Stuss und Schmonzes redet und völlig meschugge aus dem Tohuwabohu wieder ins Kaff reist, von den Ganoven Schmus hört und aus Daffke Mackes austeilt, weil es schofel ist, so viel Geseire zu hören, wenn dann, nebbich, am Ende doch die Cholera kommt. Wunderbar!
Werner Krauss, einer der bekanntesten Schauspieler seiner Zeit, auf der Goebbelschen „Gottbegnadeten-Liste“ als der wichtigsten Künstler des NS-Staates geführt, hatte sich seine sage und schreibe sechs Judenrollen in dem Hetzfilm „Jud Süß“ im Jahre 1940 mit sagenhaften 50.000 Reichsmark honorieren lassen. In entlarvender Naivität verstieg er sich zu der Aussage, die antisemitische Absicht sei deswegen nicht erreicht worden, denn Ferdinand Marian, der den „Jud Süß“ verkörperte, sei ein so „charmanter Jude“ und der Bräutigam ein „so widerlicher Goi“ gewesen, dass die meisten Frauen nachher sagten: „Mit dem Jud Süß, warum nicht“? Krauss’ Lieblingsrolle war der Shylock in Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“, doch in der NS-Zeit war er mit dieser Rolle in die Abgründe seiner Begabung geraten. Er bediente damals offenbar alles, was Antisemiten glaubten, an einem Juden hassen zu müssen. Und so stellte Kraus, der Arier, eine derart widerliche, nach Geld geifernde, plattfüßig schlurfende und tückisch glotzende Judengestalt dar, dass Gad Granach, der Sohn von Alexander Granach, in seinen Erinnerungen schreibt, bei Krauss seien die Zuschauer jeden Abend als Antisemiten aus dem Theater gegangen. All das, und noch viel mehr, erfährt man bei Birgit Lahann.
Birgit Laham: „Kennen Sie einen Juden?“ Lauter Künstler von A wie Alejchem bis Z wie Zadek, Verlag J. H. W. Dietz Nachf., Bonn 2023, 271 S., 26 Euro.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung