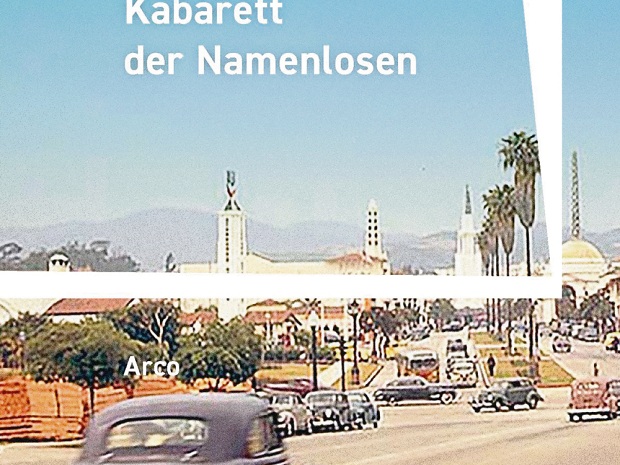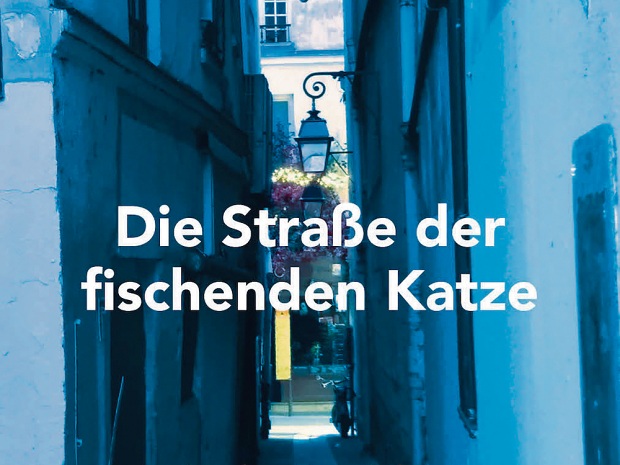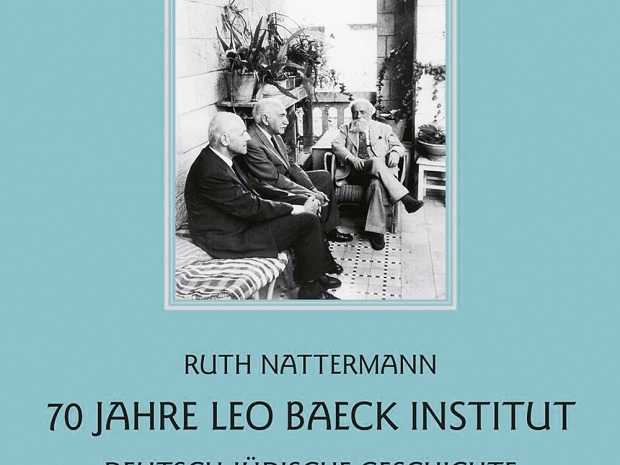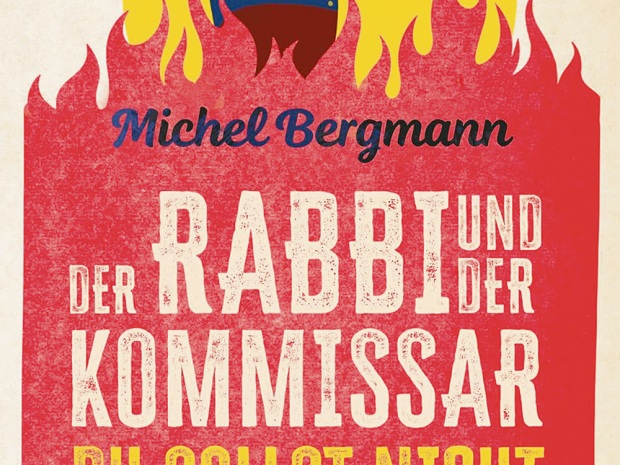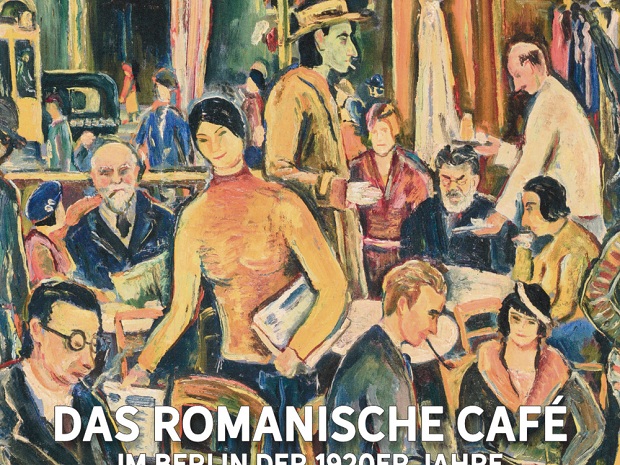Auf den Spuren des russischen Judentums von der Zarenzeit bis zur Gegenwart
Ein Reisebericht aus dem Herbst 2021 über die jüdische Kultur in den russischen Städten Kazan und Samara. (JR)

Kazan, Tempel aller Religionen. © WIKIPEDIA
Im ersten Teil dieses Reiseberichtes (JR 4/2002 [92], S. 42 f.) wurde über die jüdische Gemeinde in Ufa, der Hauptstadt der Autonomen Republik Baschkortostans, erzählt sowie über die jüdische Geschichte Samaras bis kurz nach dem 2. Weltkrieg. In den Jahren 1935-1991 wurde Samara, urkundlich erstmalig erwähnt um 1365, nach Walerian Wladimirowitsch Kuibyschew (1888-1935) benannt, u.a. ab 1927 Mitglied des Politbüros der KPdSU. Wir setzen nun unseren Rundgang in Samara fort.
Die Ruinen der Großen Choralsynagoge präsentieren sich als ein monumentales Gebäude im neo-maurischen Stil mit rot-weiß gestreiften Ziegelwänden. Außer dem Hauptturm zur Straßenfront und ein paar Außenwänden ist über die Jahrzehnte nicht viel übriggeblieben; die Innenräume sind total zerstört. Bis zum 1. Weltkrieg galt die Große Choralsynagoge mit eintausend Sitzplätzen als die größte Synagoge Europas. Die sowjetischen Behörden schlossen dieses Gebetshaus jedoch bereits im Jahre 1929 und übergaben es zuerst einem jüdischen Verein unter der Aufsicht des Komintern, der sogenannten Dritten Internationalen; es wurde ein „Haus der Kultur“. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Gebäude in eine Bäckerei umgewandelt und erst nach dem Zerfall der Sowjetunion wieder an die jüdische Gemeinschaft retourniert. Am 5. Oktober 2021 wurde in einer großen Zeremonie der Grundstein für die Restaurierung dieses Hauses gelegt, selbstverständlich unter Teilnahme des Gesandten des Lubavitcher Rebbe, Rabbiner Shlomo Deutsch, des Oberrabbiners Russlands Shlomo Dov Pinchas Lazar (1964-), besser bekannt als Berel Lazar, sowie des Gouverneurs des Samara Oblasts, Dmitry Igorevich Azarov.
Für eine Besichtigung nicht zugänglich war die ehemalige Bierbrauerei Zhigulevskoe, gegründet 1881 von dem Österreicher Alfred Vacano Ritter von Wellho (1846-1929). Ursprünglich bekannt unter dem Namen „Venskoje pivo“ (Wiener Bier), befanden die sowjetischen Behörden alsbald diesen Namen vollkommen bourgeois und machten daraus „Zhigulevskoe“, dessen Bedeutung mir leider unklar blieb, etwa, ob es mit der Stadt Schiguli (deutsch: Reckeln) in der heutigen Oblast Kaliningrad (Königsberg) zusammenhängen könnte. Zumindest unter diesem Namen wurde ab 1938 das Bier praktisch aller russischen Brauereien verbreitet und ist etwa auch heute in der Ukraine als solches bekannt.
Im historischen Bereich Samaras, der Altstadt, ist mit geübtem Auge schnell zu erkennen, dass es vor hundert Jahren eine etliche Anzahl von palastartigen Gebäuden gegeben haben muss, die jedoch zwischenzeitlich einen eher verfallenen Eindruck machen. Grandios aber nach wie vor das 1888 erbaute, nun vollkommen restaurierte Akademische Gorky-Drama-Theater sowie das Akademische Theater für Oper und Ballett, eröffnet am 1. Juni 1931 mit „Boris Godunov“ von Modest Petrovich Mussorgsky (1839-1881). Während des 2. Weltkrieges wurde auch das Bolschoiballett in dieses Haus verlegt. Schließlich ist auch ein ausgedehnter Spaziergang entlang der Wolgapromenade praktisch unverzichtbar; Wagemutige wären selbstverständlich auch für ein Schwimmen im Fluss eingeladen.
Weiter nach Kazan.
Mit einem Boot auf der Wolga sollte es nun über 360 Kilometer nördlich weiter nach Kazan gehen, des nachts vorbei an Tolyatti, vormals Stawropol-Wolschskij und benannt nach dem italienischen Kommunisten Palmiro Togliatti (1893-1964). Leider konnte diese Stadt mit 720.000 Einwohnern, die zweitgrößte Stadt der Oblast, nicht besucht werden, genauso wenig wie Uljanowsk, vormals Sibirsk, der Geburtsstadt von Wladimir Iljitsch Uljanow (aka Lenin, 1870-1924) und mit 620.000 Einwohnern auch Hauptstadt der gleichnamigen Oblast oder auch Bolgar, heute nurmehr eine kleinere Stadt, aber dennoch weit über deren Grenzen hinaus bekannt als UNESCO-Weltkulturerbe. Dass auch Bolgar wie das nur 260 Kilometer entfernte Samara im Zeitraum 1935-1991 den Namen Kuibyschew erhielt, mag eines der vielen unerklärlichen Besonderheiten der Sowjetunion gewesen sein. Wie in den drei von mir beschriebenen Städten gibt es auch in Togliatti und Uljanovsk von Chabadnikim geleitete jüdische Gemeinden.
Bevor ich schließlich in Kazan, dem Endziel meiner Russlandreise, das Schiff verließ, erreichten wir das von Iwan dem Schrecklichen im Jahre 1583 gegründete und an der Wolga gelegene Kozmodemyansk sowie mit dem Bus Tsaryovokokshaysk, ab 1927 Yoschkar-Ola, mit 250.000 Einwohnern die Hauptstadt der Autonomen Republik Mari El. Die dortige sehr kleine jüdische Gemeinde gehört in den Einzugsbereich des auf der Straße etwa 150 Kilometer entfernten Kazan. Das von mir ebendort gewählte Hotel war das „Giuseppe“ in der Kremlyovskayastraße (vormals Voskresenskaya) und mit geschmackvoll dekorierten Gängen ausgestattet, die die Atmosphäre einer venezianischen Villa zu vermitteln versuchten. Es lag praktisch in Spuckweite zur Hauptattraktion Kazans, nämlich dem „lokalen“ Kreml.
Das Wetter war regnerisch und kühl und so beschloss ich, als Erstes den „Tempel aller Religionen“, auch „Universaltempel“ genannt, zu besuchen, etwa zwölf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und im westlichen Außenbezirk Kazans gelegen, von seinem Gründer Ildar Kanov (1940-2013) selbst als „Tempel der Kultur und Wahrheit“ bezeichnet. Gegründet wurde das Projekt 1992 und ein Ende von Konstruktionen bzw. Erweiterungen des gesamten Baukomplexes ist noch nicht abzusehen. Ich konnte, durch die verschiedenen Räume schlendernd, ohne Zweifel den Islam erkennen, danach den Buddhismus sowie die russisch-orthodoxe Kirche. Eine Synagoge war allerdings unauffindbar und die Abteilung zur römisch-katholischen Kirche fiel recht kurz und eher beiläufig aus, beides etwa ganz im Gegensatz zum Kulturzentrum „Rukh Ordo“ in Tscholpon Ata, Kirgistan. Ohne Zweifel haftete dem Ganzen ein bisschen Kitsch an, als ob der gesamte Komplex aus einer anderen Welt stammte, zumindest überhaupt nicht in diesen sonst recht grauen Vorort von Kazan passte.
Mit einer Elektritschka ging es nun zurück ins Stadtzentrum und direkt zum Kazaner Kreml, vor dessen Eingang sich unübersehbar eine riesige Statue befand, und zwar das Monument des Musa Jalil (1906-1944), einem gefeierten tatarischen Widerstandskämpfer. Jalil wurde von der Wehrmacht in einer Wolga-Tataren-Kompanie eingesetzt, die alsbald meuterte und schließlich alle deutschen Offiziere erschoss. Er wurde später von der Gestapo gefangen genommen und im Februar 1944 in Berlin-Plötzensee geköpft. 1947 wurde er öffentlich als Verräter der UdSSR erklärt, 1956 jedoch als Held der Sowjetunion rehabilitiert. 1957 erhielt er den Leninliteraturpreis für seine Moabiter Tagebücher.

Samara, Choral-Synagoge. Sie wurde 1908 vom Architekten Selman Kleinerman gebaut.© WIKIPEDr
Die Renovierungen zwischenzeitlich sämtlicher Gebäude des mit einer Mauer umgebenen Gebietes des Kreml hatten erst vor etwa 45 Jahren begonnen. Anhand von Photos aus dem Jahre 1980 muss der Eindruck entstehen, dass damals, also noch zu Sowjetzeiten, fast alles dem Verfall preisgegeben war. Das sich darin befindliche ins Auge fallende und bekannteste Gebäude, die Kul Sharif Moschee, ist von innen genauso beeindruckend wie von außen, auch wenn jeder optische Vergleich dieser Innenräume mit einer russisch-orthodoxen Kirche immer zugunsten letzterer ausfallen muss. Die Verkündigungskirche innerhalb der Kremlmauern wurde im Jahre 2005 wiedereröffnet. Sie war auf den Resten einer Moschee mit acht (!) Minaretten gebaut wurde, wenngleich es sich 1552 noch um eine Holzkonstruktion handelte.
Bevor ich mir die Kazaner Synagoge anschauen wollte, kam ich an einem „Sozialistenmuseum“ vorbei, dessen Leiter nicht nur Englisch, sondern auch ein recht gutes Deutsch sprach. Besonders stolz war er auf Uniformen der NVA (Nationale Volksarmee) und weiteren DDR-Utensilien. Groß waren die Räumlichkeiten nicht, aber die Faszination muss wohl in den Details gelegen zu haben. Wahrscheinlich hätte man Tage, wenn nicht Wochen benötigt, um sich jedes einzelne Stück auch wirklich anzuschauen. Über einen Monitor wurden Schlager aus der Zeit der Sowjetunion gezeigt.
Die Synagoge selbst, erbaut 1915-1917, befand sich nur unweit des Kremls in der Profsojuznajastraße 15. Mit dem Untergang der Sowjetunion 1992 war auch dieses Gebäude, 1962 geschlossen und längst von den Sowjetbehörden enteignet, wenig überraschend dem Verfall nahe. Was insofern nicht verwunderte, da dies mit vielen historischen Gebäuden in praktisch allen Ortschaften Russlands passierte, insbesondere mit sakralen Bauten, ganz egal, welcher Denomination sie angeschlossen waren. 1996 retournierten die Kazaner Munizipalbehörden das Haus an die jüdische Gemeinde. Ohne Zweifel war für das jüdische Gemeindezentrum eine Totalrenovierung fällig. Glücklicherweise gab es noch ältere Dokumente, anhand derer man die Innenbereiche des einhundert Jahre alten jüdischen Gemeindezentrums rekonstruieren konnte. Finanziert wurden die aufwendigen Arbeiten durch Zuschüsse der Autonomen Republik Tatarstan sowie aus eigenen Gemeindemitteln, so dass das Gebäude im September 2015 neu eröffnet werden konnte. Als Gäste zu verzeichnen waren neben dem bereits weiter oben erwähnten Berel Lazar, seit dem Jahre 2000 neben Adolf Solomonovich Shayevich (1937-) einer der beiden Oberrabiner Russlands, etwa auch Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov (1957-), seit 2010 Präsident Tatarstans.
Für eine organisierte Voranmeldung hatte meine kurze Zeit in Kazan nicht ausgereicht und so beließ ich es bei einem mehr oder weniger spontanen Besuch. Das Haus war schnell gefunden, aber auch hier fehlten mir irgendwie die Sicherheitskameras um ein solches Gebäude, wie ich es bedauerlicherweise aus vielen anderen Ländern gewöhnt bin. Die Eingangstüre war versperrt, jedoch nach etwas Klopfen an der Türe erschien nach wenigen Minuten ein Wächter in nicht näher erkennbarer Militärkleidung, der mich wortlos eintreten ließ und direkt in den Synagogenraum führte. Rabbi Yitzchak Gorelik, seit über 25 Jahren als Chabad-Lubavitch-Abgesandter für die jüdische Gemeinde in Kazan tätig, war leider nicht zu sprechen. So blieb es bedauerlicherweise nur für einen kurzen Besuch mit ein paar Fotos.
Wiewohl Kazans Bevölkerung fast zur Hälfte muslimisch ist, gibt es hauptsächlich russisch-orthodoxe Gebetshäuser außerhalb des Kremls, die einen Besuch wert wären, wie beispielsweise die Kazanskii Kathedrale oder die Peter-und-Paul-Kathedrale, ganz abgesehen von so kleinen Juwelen wie etwa das Uschkova-Haus am Beginn der Kremljovskayastraße, vormals eine Privatvilla, heute Teil der Nationalbibliothek der Republik. Das herausragende Merkmal des Gebäudes war der Wintergarten, in dem alles an eine natürliche Höhle erinnern sollte, ergänzt sogar mit Stalaktiten, die von der Decke hingen.
Zu etwa gleichen Teilen, nämlich rund 48 Prozent, besteht die Bevölkerung Kazans aus Russen (meist orthodox) und Tataren (meist sunni-islamisch). Vor allem wie auch in Ufa fand ich es erstaunlich, wie in Kazan offen, vollkommen tolerant und friedlich die drei Hauptweltreligionen nebeneinander existieren. Zumindest in Samara befanden sich Muslims und Juden (und andere) gegenüber den Russischorthodoxen weit in der Minderheit. Insgesamt aber beobachtete ich in allen drei Städten ein Nebeneinander, von dem wir in weiten Teilen Europas (und anderen Teilen der Welt) im 21. Jahrhundert nurmehr träumen können. Bemerkenswert bleibt in jedem Fall, dass Dank der aktiven und nahezu unbezahlbaren Arbeit der Chabadniks das jüdische Leben auch in für Mitteleuropäer eher unbekannteren Städten Russlands erfolgreich reaktiviert wurde.
Anmerkung: Wenngleich ich Russland noch im Herbst letzten Jahres besuchte, wurden diese Zeilen erst in den ersten Tagen des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine beendet. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass ein (viel zu) großer Teil der Bevölkerung der Russischen Föderation diese eindeutige Aggression als eine „Friedensmission gegen faschistische Nationalisten“ rechtfertigt, dann vermute ich, dass eben doch noch viel zu viele der gelenkten Informationspolitik zum Opfer fallen. Russland ist für mich nach wie vor ein wunderbares Land und es obliegt dessen Bevölkerung, die korrupte und despotische Clique um Putin und den Größenwahnsinnigen selbst zurechtzuweisen.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung