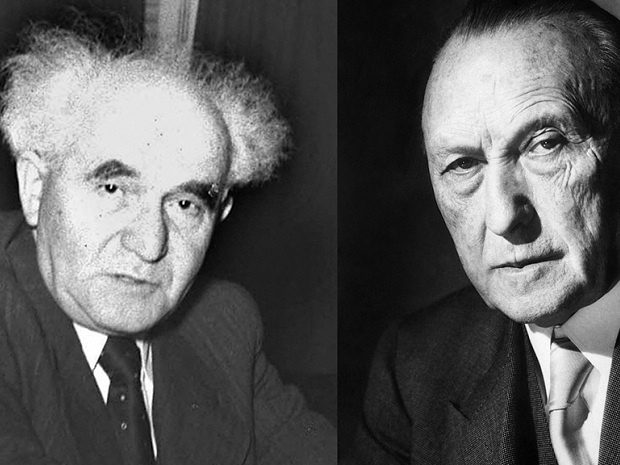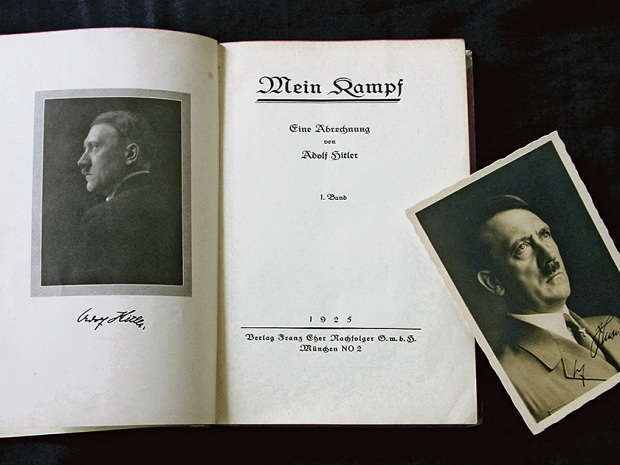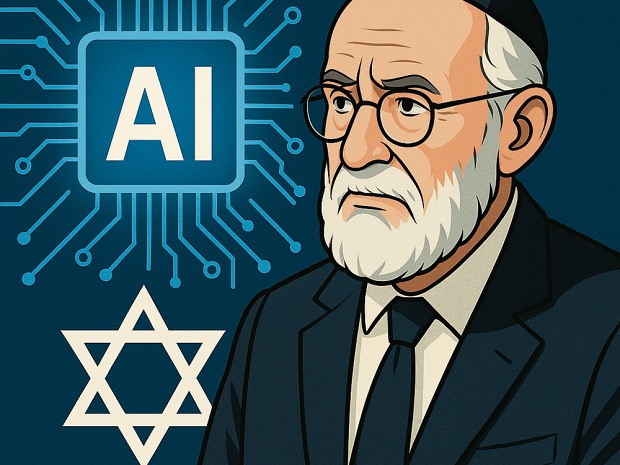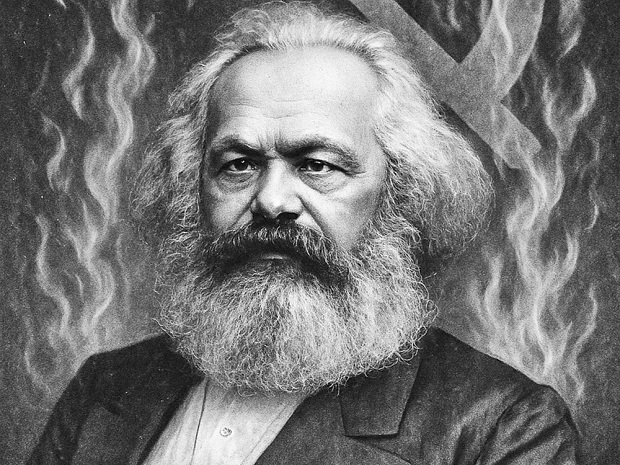Jüdisches Erbe im Burgenland: Ein Land stellt sich der Vergangenheit
Paul I. Fürst Esterházy lud 1670 die aus Wien vertriebenen Juden ein. Rund 3000 Juden folgten seinem Ruf. Dank Esterhàzy gab es in den „Sieben-Gemeinden“ eine eigene jüdische Verwaltung, eigene Ärzte und Hebammen. Die heutige Burgenländische Landesregierung pflegt dieses Andenken an das jüdische Erbe.

Den alten jüdischen Friedhof Eisenstadts gibt es seit dem Zuzug der Wiener Juden Ende des 17. Jahrhunderts. Der älteste erhaltene Grabstein stammt aus dem Jahr 1679, die letzte Bestattung fand hier 1875 statt.
Das österreichische Burgenland war immer schon etwas anders als die übrigen acht Bundesländer Österreichs. Das liegt vor allem daran, daß es erst nach Ende des Ersten Weltkriegs Teil der neugegründeten Republik Österreich wurde, weshalb das vergangene Jahr vom 100-Jahre-Jubiläum geprägt war. Davor war es über Jahrhunderte als Teil des Königreichs Ungarn, vor allem geprägt von dörflichen Strukturen und dem Großgrundbesitz adeliger Familien, von denen die Batthyánys und die Esterházys die bekanntesten sind. Beide Familien sind mit dem Entstehen der jüdischen Gemeinden eng verbunden.
Vor allem die Esterházyschen „Sieben-Gemeinden“ in Eisenstadt, Mattersdorf (heute –burg), Kobersdorf, Lackenbach, Frauenkirchen, Kittsee und Deutschkreutz gelten als Keimzelle jüdischen Lebens. Sie entstanden durch die Einladung von Fürst Paul I. Esterházy, der 1670 die aus Wien vertriebene Juden einlud, sich in seinem Herrschaftsbereich niederzulassen. Rund 3000 Juden, vor allem orthodoxe, folgten diesem Ruf. In den folgenden Jahren entwickelte sich ein vielseitiges Gemeindeleben: Es gab eine eigene jüdische Verwaltung mit niederer Gerichtsbarkeit, eigenen Ärzte, Hebammen, Schächtern und zahlreichen anderen Berufen.

Die ehemalige private Synagoge von Samson Wertheimer am Eisenstädter Oberberg gehört zu den wenigen im deutschen Sprachraum, welche das Pogrom von 1938 und die Zeit danach unbeschadet überstanden haben. Sie ist die älteste in ihrer ursprünglichen Funktion erhaltene Synagoge Österreichs. Bis 1840 hatte die ›Wertheimer'sche Schul‹, wie die Synagoge früher genannt wurde, ihren eigenen Rabbiner. Die Eisenkette am Pfeiler markiert die Grenze des ehemaligen Ghettos – mit ihr wurde am Sabbat die Gasse gesperrt. Sie ist ein Zeichen der damaligen jüdischen Autonomie.
Das jüdische Leben, das bedeutende Persönlichkeiten wie der Geiger Joseph Joachim, der Komponist Karl Goldmark oder Sándor Wolf, der Gründer des burgenländischen Landesmuseums prägten, fand ein abruptes Ende mit der Herrschaft des Nationalsozialismus. Nur wenige Monate nach dem Anschluss Österreichs verkündete Gauleiter Tobias Portschy bereits das Land als „judenfrei“, alle außer zwei Synagogen wurden zerstört. Nach Beraubung bzw. Enteignung kamen die meisten von der damals 4.000 jüdischen Burgenländer nach Wien, und zwei Drittel von ihnen gelang die Emigration nach Großbritannien, die USA oder Palästina. Mindestens 1.300 wurden ab 1939 in Ghettos und Konzentrationslagern ermordet. Nur wenige kehrten nach dem Krieg in ihre Heimat zurück, heutzutage leben nur rund ein Dutzend dort.
Auch wenn durch das Verbrechen der Nationalsozialisten die Spuren des Judentums fast ausradiert worden sind, gibt es im heutigen Burgenland engagierte Bestrebungen, um die Erinnerung an die ehemaligen Mitbürger wachzuhalten.
Die ehemalige Synagoge in Eisenstadt ist Teil des „Österreichischen Jüdischen Museums“ (ÖJM), welches 1972 als erstes seiner Art in Österreich gegründet wurde. Diese – im Übrigen immer noch geweihte – Synagoge ist die älteste ihrer Art und noch immer in seiner Funktion bestehende im ganzen Land. Die Synagoge von Stadtschlaining im Südburgenland wurde in den 1980er Jahren vom Österreichischen Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung gekauft und renoviert und dient als „Friedensbibliothek“ gewissermaßen immer noch einem „spirituellen“ Zweck. Von derselben Stadt ging 2001 die Einladung „Welcome to Stadtschlaining“ aus, die an vertriebenene Schlaininger und ihre Nachkommen erging.
Der frühere Landeshauptmann Niessl rief 2010 das Projekt „Erinnerungszeichen“ ins Leben, mit welchem die Sanierung alter jüdischer Friedhöfe in Kooperation mit Schulen gleichzeitig als Bildungsarbeit betrieben wird. Diese scheint insoweit erfolgreich, da die Verlegung der ersten Stolpersteine im Burgenland im letzten Jahr von Schulprojekten ausging: Ausdrücklich mit handgefertigten Originalen des deutschen Künstlers Gunter Demnig. Das ist insofern bemerkenswert, da man sich in der „barrierefreien“ Bundeshauptstadt Wien am Begriff „Stolpersteine“ stört und sich stattdessen mit industriell hergestellten „Steinen der Erinnerung“ behilft. Auch Landtagspräsidentin Verena Dunst nahm persönlich an der Verlegung teil: „Das jüdische Erbe in unserem Bundesland ist ein wichtiger Teil unserer Erinnerungs- und Gegenwartskultur und darf nicht in Vergessenheit geraten. Deshalb lade ich besonders die Jugendlichen ein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und unsere zahlreichen Gedenkstätten zu besuchen.“

Wie man an der Tafel von 1982 sieht, bemüht man sich im Burgenland bereits seit über 40 Jahren, das historische Erbe nicht nur zu dokumentieren, sondern auch wach zu halten.
Auch für den aktuellen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) steht fest, dass „das Judentum und die jüdische Kultur wichtiger Bestandteil der österreichischen Identität“ seien. Von ihm ging auch die Initiative aus, das Jüdische Zentralarchiv, einer bislang als Landesarchiv geführten Behörde, 2020 in die Obhut der Israelitischen Kultusgemeinde Wien zu übergeben. Gemeinsam soll der Aktenbestand digitalisiert und online zugänglich gemacht werden. Laut Doskozil „ein Quantensprung für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der jüdischen Geschichte und Kultur – vor allem auch im Bereich der jüdischen Alltagskultur“.
Wie viele christliche Burgenländer hingen auch die jüdischen sehr an ihrer Heimat: Der letzte Rabbiner von Mattersburg, Shmuel Ehrenfeld, emigrierte 1938 nach New York und gründete dort die Gemeinde "Kirjat Mattersdorf". Zwanzig Jahre später kaufte er im Norden Jerusalems Land für seine Gemeinde, welche in Folge von seinem Sohn Akiva Ehrenfeld geleitet wurde. Die orthodoxe Gemeinde ist das lebendigste Relikt der Siebengemeinden, welche eingedenk ihrer Tradition auch eine eigene Jeschiwa, wie damals in Mattersburg, unterhält. Nach dem österreichischen Bundespräsidenten Thomas Klestil im Jahr 1994 besuchte auch Landeshauptmann Hans Niessl im Jahr 2008 Kirjat Mattersdorf. Dort wurde er, insbesondere im Altersheim, von ehemaligen Burgenländern sehr freundlich aufgenommen, die „ihren“ Landeshauptmann begrüßten.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung
Menschen und Wissen