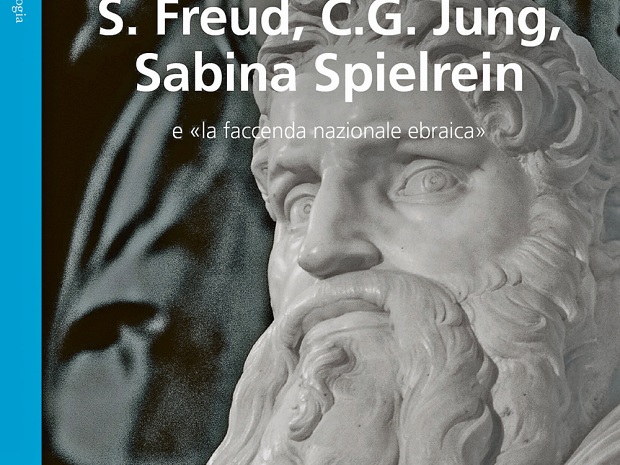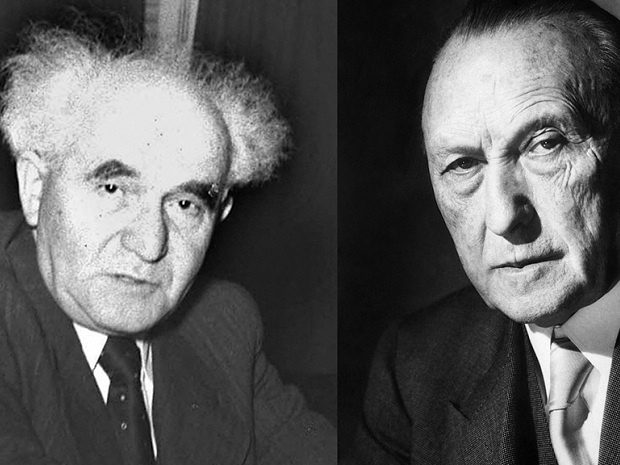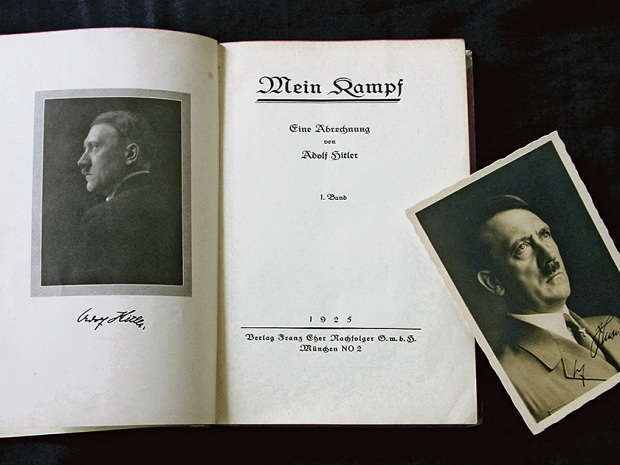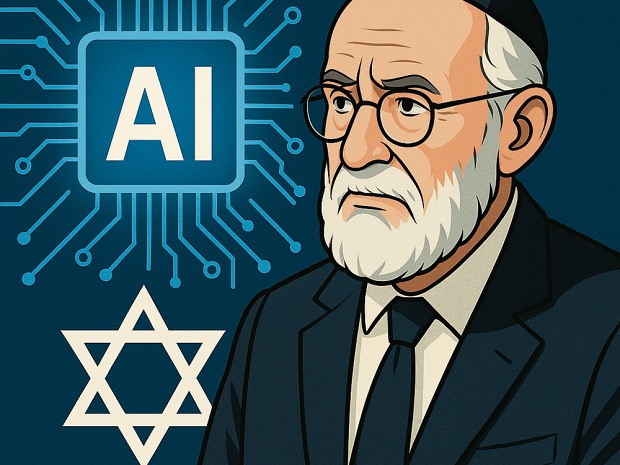Tödliche Wirkung: Tiefsitzender Judenhass hat sich in der christlichen Kunst und vielen christlichen Bauten niedergeschlagen
Das Motiv, Juden hätten Jesus verraten und ermordet, ist von Anfang an im Gedankengut der Kirche verankert. Diese antisemitische Vorstellung findet sich später auch bei Martin Luther, der ausschließlich den Juden die Schuld am Tod Jesu zuschreibt, und behauptet, dass das Christentum der „wahre“ Glaube und die Juden „Abtrünnige“ seien.

Eine Skulptur der Synagoga (rechts) an der Trierer Liebfrauenkirche: Die Frau steht symbolisch für das Judentum, das blind sei, dessen Stab zerbrochen ist und dessen Gesetzestafeln auf dem Kopf stehen.© WIKIPEDIA
Hinter einer Absperrkordel geht es ein paar Steinstufen hinauf. Hier, im Westchor der Nürnberger St. Sebaldkirche, hängt ein Epitaph aus dem 15. Jahrhundert. In der Bildmitte steht Jesus, umringt und bedrängt von einer wütenden Menge. Ein Mann drückt ihm mit Gewalt eine Dornenkrone auf den Kopf, ein anderer holt mit der Hand zum Schlag aus. Unterdessen stecken am Bildrand ein paar Männer konspirativ die Köpfe zusammen. Der eine trägt ein Stirnband mit hebräischen Schriftzeichen, der andere hält eine jüdische Schriftrolle in der Hand.
Die Botschaft des Bildes ist eindeutig: Die Juden haben sich gegen Jesus verschworen, sie agieren im Hintergrund, machen sich aber die Finger nicht schmutzig. Das Gemälde greife einen gängigen Verschwörungsmythos auf, bei dem Juden als finstere Gestalten und Strippenzieher im Hintergrund für den Tod Jesu verantwortlich gemacht werden, sagt der evangelische Theologe Axel Töllner. Die Bildaussage: „Bei allem, was den Leidensweg Jesu angeht, haben die Juden die Finger im Spiel.“ Axel Töllner war mehrere Jahre Gästepfarrer an der Nürnberger St. Sebaldkirche. Seit 2014 ist er Beauftragter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für den christlich-jüdischen Dialog. Beim Rundgang durch die Kirche hat er einen Flyer dabei, den die evangelische Kirchengemeinde St. Sebald schon vor etlichen Jahren entworfen hat und der sich mit der judenfeindlichen Kunst in der Kirche auseinandersetzt. Das Flugblatt liegt in der Kirche aus.
Denn die Darstellung ist bei weitem nicht das einzige Kunstwerk in der Kirche, das eine judenfeindliche Handschrift trägt. Im Hauptschiff der Kirche hängt an einer Säule seitlich des Altarraums eine Passionsdarstellung aus dem 15. Jahrhundert: Eine Menschenmenge folgt Jesus auf dem Weg von Jerusalem nach Golgatha, wo er ans Kreuz geschlagen wird. An wichtigen Wegpunkten sind immer wieder Personen zu sehen, die beispielsweise durch einen jüdischen Gebetsmantel oder hebräische Schriftzeichen als Juden erkennbar gemacht wurden. „Diese ganze Bildergeschichte erzählt, dass an allen Stationen der Passion Jesu die Juden schuld gewesen sind“, sagt Axel Töllner. „Sie verspotten Jesus, sie quälen ihn, wenn er unter dem Kreuz zusammenbricht, sie hetzen die Meute auf.“
Die Juden als Christusmörder ist ein Narrativ, das sich nicht nur in St. Sebald findet. „Es ist ein Topos, der sich durch die Kirchengeschichte zieht“, sagt der Antisemitismus-Beauftragte der EKD, Christian Staffa. Der 1. Thessalonicherbrief spricht im Rahmen einer innerjüdischen Auseinandersetzung davon, dass die Juden Jesus getötet haben. „Das Verrat- und das Mordmotiv sind von Anfang an in der Alten Kirche verankert“, sagt Staffa. Die Vorstellung finde sich später dann auch bei Martin Luther, der den Juden die Schuld am Tod Jesu zuschreibt. Die Juden sind in Luthers Augen abgefallen vom wahren Glauben.
Verworfenes Volk?
Schaut man sich in der christlichen Kunst um, lässt sich ein weiteres theologisches Konzept entdecken, das das Verhältnis von Juden und Christen beschreibt. Christian Staffa verweist auf die sogenannte Substitutionslehre, also die Vorstellung, dass Gott das Volk Israel verworfen hat und die Kirche als neues Volk Gottes Israel ersetzt. Es ist ein Denken, von dem sich beide großen Kirchen inzwischen distanziert haben. In den Darstellungen von Ecclesia und Synagoga, wie sie sich heute noch vielerorts finden, kommt diese Vorstellung nach wie vor zum Ausdruck.
Seit dem 9. Jahrhundert, so hat es der katholische Theologe Herbert Jochum recherchiert, finden sich auf in Elfenbein geschnitzten Buchdeckeln, in Handschriften oder auf Glasfenstern Darstellungen der allegorischen Frauenfiguren Synagoga und Ecclesia. Im Mittelalter, als in Straßburg oder Bamberg das große Münster beziehungsweise der Dom errichtet werden, erhält das Paar in den Bauwerken einen prominenten Platz.
Am Fürstenportal des Bamberger Doms sind die Frauengestalten Ecclesia und Synagoga eingebunden in das Szenario des Jüngsten Gerichts. Die Kirche triumphiert als Königin, ihr gegenüber steht die Synagoge als Sinnbild für das verblendete Judentum: Sie trägt eine Augenbinde, hat einen zerbrochenen Stab in der Hand, die Gesetzestafeln fallen ihr aus der Hand.
Das Motiv findet sich auch andernorts mit teils drastischer Bildsprache. Auf einem Passionsfenster in der Kathedrale von Chartres schießt der Teufel einen Pfeil ins Auge der Synagoga. Auf einem Passionsbild in der Wiesenkirche in Soest stößt ein Engel die Synagoga mit einer Lanze vom Kreuz weg. Und in einer elsässischen Historienbibel aus dem 15. Jahrhundert sitzt der Teufel auf der Schulter der Synagoga und reißt ihr die Krone vom Kopf. Der Vorsitzende der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft des Saarlands, Herbert Jochum, der schon vor Jahren eine Ausstellung zu Ecclesia-Synagoga-Darstellungen in der christlichen Kunst erarbeitet hat, spricht von einer „Geschichte einer Ausgrenzung“ und verweist auf die „letztlich tödliche Wirkung antijüdischer Sprach- und Bildsymbole“.
Wie zerstörerisch dieses Denken wirken konnte, zeigt sich in Regensburg. Hier wurde die Allegorie von Ecclesia und Synagoga bittere Realität. Als die Regensburger Bürger 1519 die Juden aus der Stadt vertrieben, zerstörten sie nicht nur ihre Häuser und schändeten den jüdischen Friedhof, sie rissen auch die Synagoge im jüdischen Viertel ab. Am Ort der Synagoge errichteten sie eine hölzerne Wallfahrtskapelle für Maria. „Es soll sozusagen bewusst das Gotteshaus der einen Religion durch ein Gotteshaus der anderen Religion, der wahren Religion überbaut werden“, sagt der Historiker und Stadtführer Matthias Freitag.
Die hölzerne Wallfahrtskirche existiert heute nicht mehr; in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem ehemaligen Holzbau entstand eine größere, aus Stein gebaute Wallfahrtskirche, die heutige Neupfarrkirche. 2005 hat der israelische Künstler Dani Karavan auf dem Fundament der ersten jüdischen Synagoge ein begehbares Bodenrelief mit weißen Betonzylindern und Sitzflächen entworfen. Es ist ein Begegnungsort für die Regensburger und ein Denkmal, das an die Zerstörung der ersten jüdischen Synagoge vor mehr als fünfhundert Jahren erinnert.
Grabsteine als Trophäen?
Spuren dieses Pogroms sind heute noch an vielen Orten in der Stadt zu finden. Regensburger Bürger haben damals die Grabsteine des jüdischen Friedhofs an mehreren Orten in der Stadt verbaut. An den Türmen der Neupfarrkirche unweit der ehemaligen Synagoge lassen sich heute noch hebräische Inschriften erkennen. Auch am Alten Rathaus wurde ein jüdischer Grabstein eingebaut. Über die Hintergründe, warum die Grabsteine hier eingemauert wurden, lasse sich nur spekulieren, sagt der Historiker Matthias Freitag. Wurden die Grabsteine als billiges Baumaterial recycelt oder stellte man sie als Trophäe zur Schau?
Nicht immer ist die Absicht aus Sicht des Historikers Matthias Freitag so offensichtlich wie im folgenden Fall: In der Tordurchfahrt eines Hauses in der Regensburger Altstadt, das nach den Worten von Matthias Freitag einem Angehörigen der Führungsschicht der Stadt gehört haben muss, hängt gut sichtbar ein jüdischer Grabstein. „Man hat die Leute nicht nur vertrieben, ihre Häuser zerstört, ihren Friedhof zerstört, sondern war darauf entsprechend stolz und hat sich eine Trophäe, die eben an diese Vertreibung und Zerstörung erinnern sollte, mit nach Hause genommen und da, wo Besucher das Haus betreten, werbewirksam positioniert“, sagt Matthias Freitag.
Und das ist längst nicht alles. Nur ein paar Häuser weiter, im ehemaligen Kerker der Stadt, findet sich ein jüdischer Grabstein mit einem Loch in der Mitte, der als Abort missbraucht wurde. Die Gefangenen mussten auf der Grabsteininschrift ihre Notdurft verrichten. „Die Verwendung des jüdischen Grabsteins als Abort ist eine bewusste Schändung“, sagt Matthias Freitag. Der Grabstein im einstigen Kerker legt Zeugnis davon ab, wie tief der Judenhass im Mittelalter ging.
Spuren des Judenhasses und der Judenfeindschaft finden sich in Regensburg aber auch in Kirchen. Im 18. Jahrhundert etwa malte ein Künstler in der Stiftspfarrkirche St. Kassian ein judenfeindliches Deckenfresko, das Juden des Ritualmords an Kindern bezichtigt. Und am Dom in Regensburg findet sich, gegenüber des ehemaligen Eingangs zum jüdischen Viertel, bis heute eine antisemitische „Judensau“-Plastik, die dort lange vor dem Pogrom 1519 angebracht wurde. Immer dann, wenn ein jüdischer Regensburger sein Viertel verlassen habe, sei ihm durch die Schmähplastik gespiegelt worden, was man auf der anderen Seite von ihm halte, sagt Matthias Freitag. „Das ist schon eine ganz heftige Diskriminierung und ein Verächtlich-Machen im öffentlichen Raum.“
Diese Form der Diskriminierung ist dabei kein Einzelfall. Etwa dreißig antisemitische „Judensau“-Darstellungen gibt es in Deutschland – in Calbe, Goslar, Heilsbronn oder Brandenburg an der Havel. Prominentestes Beispiel ist die Schmähplastik in Wittenberg. Ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde hatte sich durch die Darstellung diffamiert gefühlt und geklagt. Er will, dass die Plastik entfernt wird. Inzwischen – wohl auch durch die Auseinandersetzung in Wittenberg – wird der Umgang mit den Schmähplastiken breit diskutiert.
Ein Runder Tisch
In Regensburg, wo der Freistaat Bayern Eigentümer des Doms ist, kam Anfang März dieses Jahres auf Einladung des bayerischen Antisemitismusbeauftragten Ludwig Spaenle ein Runder Tisch zusammen. Gemeinsam verständigten sich Vertreter von Kirche, jüdischer Gemeinde und Freistaat darauf, am Dom ein neues Hinweisschild anzubringen. Eine Historikerin soll einen Textvorschlag erarbeiten, der eine umstrittene, von vielen als euphemisierend und unzureichend empfundene Hinweistafel ersetzt, die seit 15 Jahren unterhalb der Skulptur hängt. Davon, die Skulptur ganz abzunehmen, hält Spaenle nichts. „Das gehört zu diesem baulichen Erbe, und es muss eben eingeordnet und erläutert werden“, sagt er. Als Warnung, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Spaenle plant zudem einen bayernweiten Runden Tisch zu den antisemitischen Schmähplastiken im Freistaat. Coronabedingt konnte dieses Treffen bislang jedoch nicht stattfinden.
In Nürnberg, wo außen am Ostchor der St. Sebaldkirche, in etwa sieben Metern Höhe, eine sogenannte Judensau-Plastik hängt, hat sich der Kirchenvorstand vor 15 Jahren deutlich von dem Gedankengut distanziert und eine Erklärung veröffentlicht, die auch eine Bitte um Vergebung enthält. „Das ‚Judensau‘-Schmähbild aus dem Spätmittelalter drückt den Judenhass aus, der die Schoa vorbereitet hat“, heißt es darin. Und weiter: „Im selben Ungeist sind jüdische Bürger Nürnbergs bis ins 20. Jahrhundert verachtet und verteufelt, vertrieben und vernichtet worden.“ Das antisemitische Relief ist nach wie vor ein Dorn im Fleisch. Axel Töllner spricht sich dagegen aus, die Skulptur zu entfernen. „Ich denke, dass es für uns ein Mahnmal ist für die Abgründe, die der christliche Glaube annehmen konnte, und für die Schattenseiten unserer eigenen Geschichte“, sagt Axel Töllner. Sich dieser Geschichte zu stellen, ist eine dauerhafte Aufgabe und Herausforderung.
Zuerst erschienen in "Zeitzeichen - Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft"
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung
Menschen und Wissen