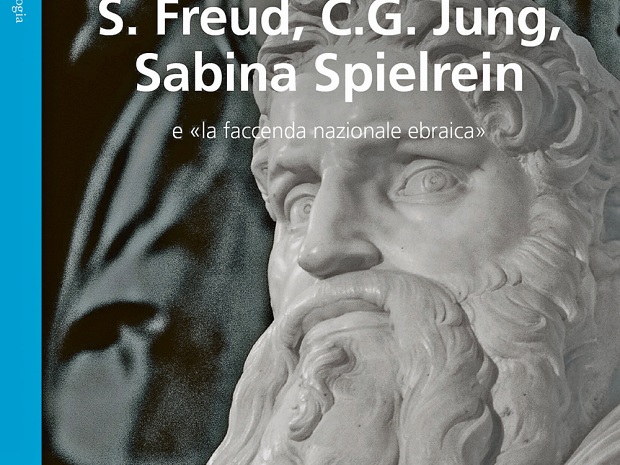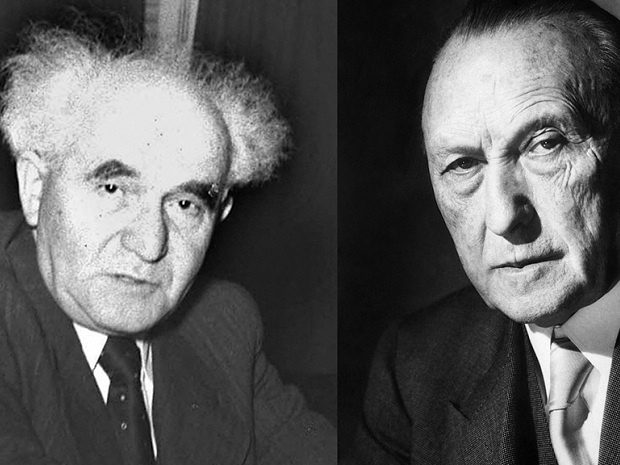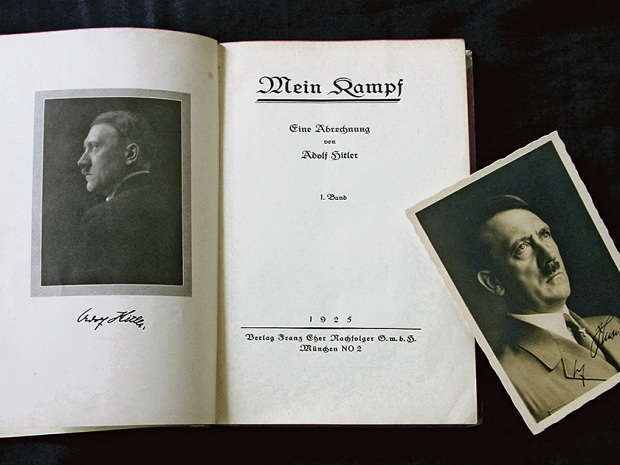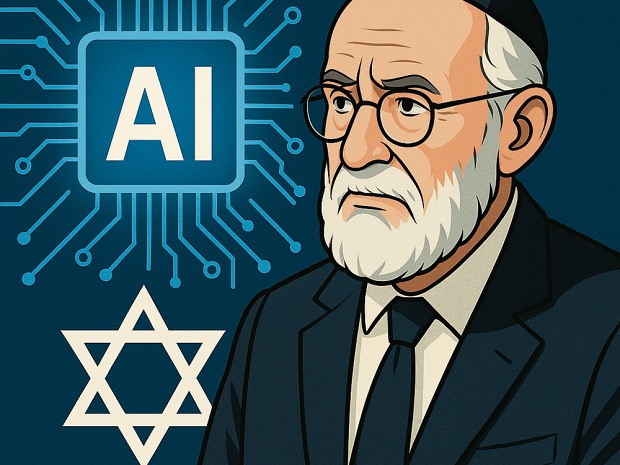Die Stadt Maria Magdalenas
Die Erlebnisse des pensionierten Bäckermeisters Wilfried Schroths, der ehrenamtlich in Israel bei archäologischen Ausgrabungen hilft

Der ehrenamtlicher Ausgrabungshelfer Wilfried Schroth
„Als die Legionäre Christi hier am See Genezareth einige Grundstücke erwarben und ein mexikanischer Investor ein Hotel bauen wollte, beteten sie zu Gott: Bitte lass uns nichts finden, aber wenn schon, dann etwas sehr Großes. Ihr Gebet wurde erhört. Was sie fanden, war ein Geschenk Gottes“, erzählt Wilfried Schroth. Er stammt aus dem Bodenseegebiet, ist Bäckermeister gewesen; nun im Rentenalter lebt er sechs Monate im Jahr, Herbst und Winter, mit seiner Frau im Heiligen Land. Seit 2000 ist er in Israel, zehn Jahre später zog er nach Migdal und beteiligt sich an den Ausgrabungen – ohne Bezahlung, versteht sich. Bald wird er für immer hier wohnen. Er trägt ein tiefblaues T-Shirt mit der Aufschrift „Duc in altum“, was so viel wie „Fahr hinaus ins Weite“ bedeutet.
Warum folgt jemand so einem Plan? Er könnte doch sein Leben in aller Ruhe in seinem Haus in einem der beschaulichen Teile Deutschlands verbringen und seine Rente genießen.
„Gerade das will ich nicht“, stellt er fest und unterstreicht seine Worte mit energischen Handbewegungen. „Ich bin kein Israel-Fan, aber ich trage Israel im Herzen. Dann muss man etwas tun.“ Er sagt es so selbstverständlich, dass ich gar nicht dazu komme, die Worte pathetisch zu empfinden. Schroth gehört keiner der Volkskirchen an, er ist Christ, jedoch freikirchlich. Migdal sei Hebräisch, erfahre ich, und bedeute übersetzt „Turm“. Auf Aramäisch, der Sprache Jesu, heißt die
Stadt Magdala. Die Stadt gab Maria Magdalena den Namen, wahrscheinlich wurde sie sogar hier geboren. Fest steht, dass Jesus sie besucht hat. Sie war nicht nur seine Begleiterin, sondern auch Zeugin seiner Kreuzigung und Auferstehung.
Im Philippusevangelium, das 1945 in Ägypten gefunden wurde, heißt es, Jesus liebte Maria Magdalena mehr als alle Jünger und küsste sie oft auf den Mund. Vor einigen Jahren stieß man in der Ruinenstätte Qumran am Toten Meer erneut auf Schriftrollen aus dem antiken Judentum in Tongefäßen; in den fünfziger Jahren hatte man bereits über 800 entdeckt. Jesus wird nun auf einem Stück Papyrus zitiert, er spricht von Maria Magdalena als seiner Frau, was einer unerhörten Offenbarung gleichkommt. Ohne in Spekulationen à la Dan Brown verfallen zu wollen: Diese Aussage bestätigt nicht nur seit Langem gehegte Vermutungen, Jesus erhöht Maria Magdalena und gesteht der Frau an sich eine ganz neue Würde zu.
Die Speisung der 5.000
Schroth erzählt, dass Magdala einer der größten Orte Galiläas gewesen sei, in dem nach dem römisch-jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus 37.000 Einwohner lebten. Wie leicht konnten 5.000 von hier in Tabgha gewesen sein, um Jesus zu hören, denke ich, und anschließend von ihm beköstigt zu werden; für die wenigen Kilometer brauchte man zu Fuß nicht mehr als ein paar Stunden. Die römisch-katholische Kirche in Tabgha, die auf byzantinischen Vorgängerbauten aus dem vierten und fünften Jahrhundert errichtet wurde, erinnert an die wundersame Brot- und Fischvermehrung. Nazareth dagegen wies in dieser Zeit nicht einmal eintausend Einwohner auf. Die jüdische Rebellion 66 nach Christus läutete das Ende der Stadt ein, zwei Jahre später eroberten römische Legionäre Magdala, sie griffen von der Seeseite her an, das Wasser soll vom Blut der Opfer rot gefärbt gewesen sein. Die Sieger verkauften 30.000 Menschen in die Sklaverei, die Stadt wurde zerstört.
Wilfried Schroth führt mich durch die vom Schutt der fast 2.000 Jahre befreiten Straßenzüge. Es ist, als führte er mich durch seine eigene Stadt. Die Wände der Häuser erheben sich kniehoch. Wir betreten die Synagoge, sie ist die älteste in Galiläa. Anhand der mit vielen Schmuckelementen gestalteten Steine ist zu erkennen, dass die Stadt reich gewesen sein muss. Im Zentrum des Baus erhebt sich das Podest, auch Magdala-Stein genannt, auf dem die Thora zum Gebet abgelegt wurde. Er zeigt auf der Frontseite eine eingravierte Menora, den siebenarmigen Leuchter, der die Tage der Woche symbolisiert. Die Ausgrabung dieses Steins ist nach offiziellen Angaben der aufsehenerregendste archäologische Fund der letzten 50 Jahre in Israel (natürlich sehen wir nur eine Kopie). Wir erreichen die Wohnbereiche der Wohlhabenden, dann die Viertel der ärmeren Bevölkerung mit den kleineren Räumen und schmaleren Wänden, schließlich die Ställe und Fisch verarbeitenden Orte.
Magdala bezog seinen Reichtum aus dem See, die Fische von hier waren sogar in Rom beliebt. Sie wurden dort lebend angeboten. Ob sie die weite Strecke tatsächlich überstanden? Wilfried Schroth nickt heftig, Flavius Josephus ist sein Gewährsmann.
Die israelische Denkmalschutzbehörde verbietet, Häuser wieder aufzubauen, etwa um sich ein plastisches Bild von der Stadt machen zu können. Die Behörde kontrolliert regelmäßig, was sich auf dieser Anlage abspielt. Als wir den Marktplatz betreten, haben wir im Gegensatz zu allen anderen Bereichen den originalen Fußboden unter uns, kleinteiliges Pflaster, Mosaiken, alles sorgfältig restauriert. „Hier, ganz sicher über diese Steine ist Jesus gelaufen. Wir wissen nicht, wo Maria Magdalena gewohnt hat. Aber über den Marktplatz ist er auf jeden Fall gegangen.“ Schroths Stimme bleibt so unprätentiös wie zuvor. Es ist ein kleines, überschaubares Areal, das nur einen Teil des ursprünglichen Platzes repräsentiert, der andere Bereich harrt noch der Ausgrabung. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße erheben sich die Ausläufer des Berg Arbel. In die offenen Höhlen haben sich Ziegen zurückgezogen, die gelassen auf die Überreste der Stadt, auf den in der Hitze flirrenden See blicken – wie in biblischen Zeiten. In diesen Höhlen suchten Menschen vor Unwetter Schutz, versteckten sich vor Soldaten, dort wurden die Toten bestattet.
Ich erkundige mich nach der jüdischen Umgebung, wie sie auf die Ausgrabungen reagiert, die von Ausländern, von Christen zumal, vorgenommen werden.
„Sie schauen schon etwas verwundert“, meint Schroth und fährt sich durchs graue Haar, „es ist ja ihre eigene Geschichte, die sie im Grunde selbst in die Hand nehmen würden. Sie fühlen sich übergangen. Aber wer das Geld hat, hat das Sagen. Das ist schließlich überall so.“ Dagegen verstehen Juden das Interesse an Jesus nicht unbedingt: Für sie ist er niemand anderer als ein Schreinersohn aus Nazareth. Unmittelbar neben dem antiken Marktplatz erhebt sich eine Kirche mit hohen Räumen, die Wände mit Mosaiken geschmückt. Der neue Sakralbau soll eine Stätte der Ökumene werden. So weist der zentrale Gebetsraum kein Kreuz auf, lediglich ein Mast mit Querbalken in einem Boot bestimmt die Stelle neben dem Altar. Neben Katholiken, Protestanten und Orthodoxen sollen sich hier ebenso Nichtchristen wohlfühlen.
Überallher aus Deutschland kommen engagierte Menschen und wollen mitarbeiten. „Dort drüben, die Häuserzeile haben junge Leute aus Duisburg mitausgegraben. Woher kommen Sie?“, fragt Schroth unvermittelt.
Sächsische Israelfreunde
Er spricht voller Anerkennung von den Sächsischen Israelfreunden, die vor kurzem hier gewesen seien. Es handelt sich überwiegend um Handwerker, um Maurer, Maler, Fliesenleger und Installateure. Sie opfern ihren Urlaub, bezahlen den Flug, die Unterkunft. Die Sachsen richten Wohnungen vor, reparieren, was instandgesetzt werden muss, und liefern noch das Material dazu. Sie kümmern sich um die Holocaustüberlebenden, die nun um die neunzig sind. Von den noch 200.000 lebt über ein Drittel unterhalb der Armutsgrenze. Der Verein der Sächsischen Israelfreunde mit Sitz in Rossau wurde 1998 anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Staates Israel gegründet. Natürlich könnte man auch Geld spenden, aber dann käme das Zwischenmenschliche zu kurz. Sie reden miteinander und hören vor allem zu, sie singen und beten mit den Leuten, die fragen, warum ihnen so viel Gutes angetan wird. Wiedergutmachen lässt sich nicht, was geschehen ist. Aber für die Aussöhnung kann man etwas tun.
„Auf Wiedersehen“, sagt Wilfried Schroth, der Mann, der seine Aufgabe gefunden hat, „ich muss dringend weiter.“
Ich schlendere zum Wagen, während ich Mispeln esse, handtellergroße säuerliche Früchte, die teigig schmecken und den Durst löschen.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung
Menschen und Wissen