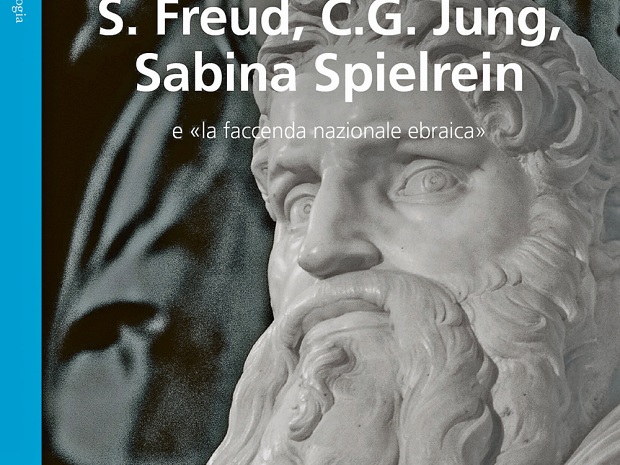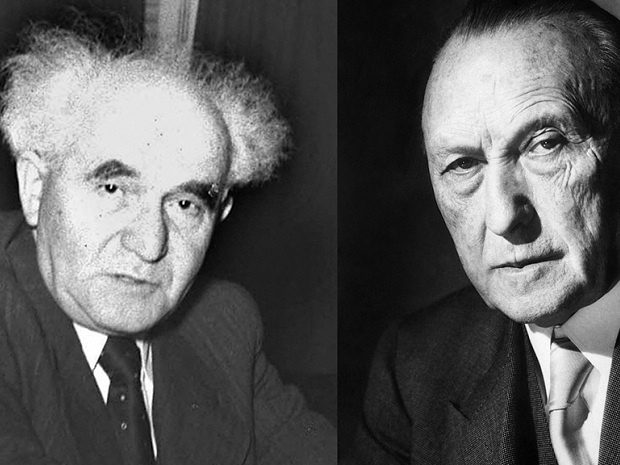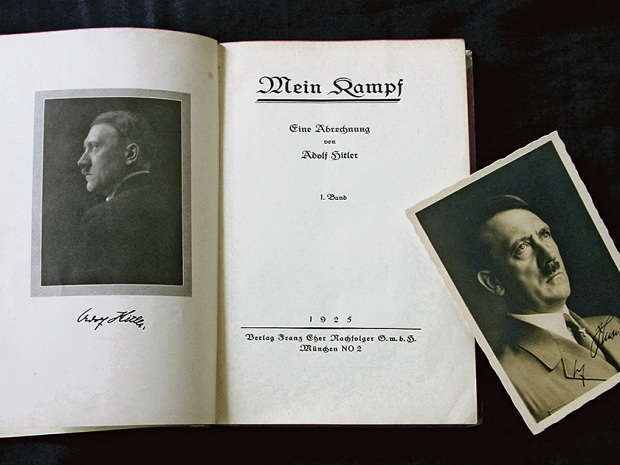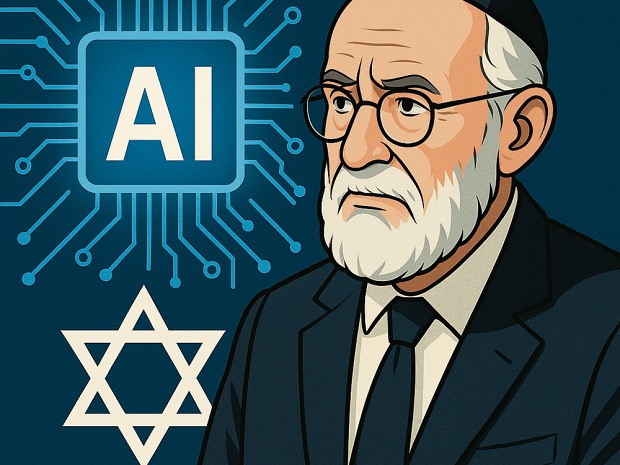„Alle Juden sind reich“
Das alte antisemitische Vorurteil und die Realität

Ein jüdischer Bettler am Busbahnhof von Tel Aviv
Heute wird jede Behauptung einem Faktencheck unterzogen und an dieser Stelle wird nun der bekannte und von den Antisemiten mantra-artig wiederholte Ausspruch, alle Juden seien reich, auf seinen Wahrheitsgehalt überprüft.
Den neuesten Fall hat der skandalöse Artikel im „Spiegel“ vom 12. Juli 2019, betitelt „Lobbyismus im Bundestag: Wie zwei Vereine die deutsche Nahostpolitik beeinflussen wollen“, geliefert. Eine Gruppe von Journalisten schreibt sich ihre antisemitischen Ressentiments von der Seele, in einer Manier, die an die unseligsten Pamphlete der als überwunden geglaubten mörderischen Zeit erinnern. Da Israel heute als Ersatz für den Juden als Ziel der Attacken dient, bleiben die alten Stereotypen bestehen und auch hier wird mit dem angeblichen Geld der Juden operiert, das die deutschen Parlamentarier korrumpiert und zum angeblichen Werkzeug der „Zionisten“ mache. Der Artikel ist unredlich und der „Spiegel“ beharrt auf seinen falschen, bereits widerlegten Behauptungen und weist den Vorwurf des Antisemitismus natürlich von sich.
Zinsen waren eine Sünde, die den Christen nicht zuzumuten war
„Juden und Geld“ ist ein Reizthema seit es in der Bibel (Exodus 22,24) hieß: „Wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, der arm ist, sollst ihm nicht schaden und keinen Wucher mit ihm treiben“. Das frühe Christentum (und dann der Islam) übernahm das Zinsverbot, das die Katholische Kirche bis ins 19. Jahrhundert beibehielt. In späteren Synoden wurde es gar zum Kapitalverbrechen erklärt, so dass die Juden als Sünder und Verbrecher galten, denn im Mittelalter, als Juden in Mitteleuropa aus der Wirtschaft – den Zünften und der Hanse – verdrängt wurden, übertrugen ihnen die Christen das Geschäft des Geldverleihs, umgingen so das Zinsverbot, aber blieben selbst ohne Sünde. Dennoch zogen die Juden den Zorn, Neid und Hass der christlichen Nachbarn auf sich, dem Mythos des geldgierigen Juden die Grundlage liefernd, der neben dem Vorwurf des Gottesmordes u.a. zu Vertreibungen, Ausgrenzung und Pogromen führte. Die Kontinuität der antijüdischen Bilder hat im Nationalsozialismus ihren mörderischen Höhepunkt erreicht. So verfälschten 1940 die Nationalsozialisten auch die historische Figur des Joseph Süß Oppenheimer, der ein respektierter Hoffaktor und Schutzjude des Württemberger Herzogs Karl Alexander im 18. Jahrhundert war. Nach dem Tod des Herzogs fiel er unschuldig einem Justizmord zum Opfer, wurde hingerichtet und sein Leichnam sechs Jahre lang öffentlich im Käfig zur Schau gestellt. Die Nazis machten ihn zu einem hinterlistigen reichen Juden in dem antisemitischen Film „Jud Süss“ unter der Regie von Veit Harlan. Er wurde zu einem NS-Blockbuster. In den europäischen Literaturen, die Spiegel der Gesellschaft sind, wurde dieses Bild des reichen, gnadenlosen Wucherjuden weiter tradiert. Allen ist die Figur des blutrünstigen Geldverleihers Shylock aus Shakespeares Komödie (sic!) „Kaufmann von Venedig“ oder des reichen Juden „Nathan der Weise“ aus dem gleichnamigen Drama von Lessing geläufig. Der geldgierige Jude Veitel Itzig aus dem „Buch der Deutschen“ im 19. Jahrhundert, Gustav Freytags „Soll und Haben“, ist heute wohl weniger präsent wie wahrscheinlich die Juden-Figuren von Dickens, wie der diebische Fagin in „Oliver Twist“, der reichen Ebenezer Scrooge und Jacob Marley aus „Eine Weihnachtsgeschichte“.
Ignatz Bubis und Joschka Fischer
Diese negativen Figuren wurden Mitte der 1970er Jahre von Rainer Werner Fassbinder in seinem skandalumwitterten Stück „Der Müll, die Stadt und der Tod“ nach dem Roman von Gerhard Zwerenz „Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond“ auf die damalige Gegenwart in Frankfurt a. M. übertragen. Darin benutzt ein Immobilienspekulant, ein „reicher Jude“, die Menschen, um sich zu bereichern. Es war vor allem eine bekannte jüdische Persönlichkeit, gegen die sich der sogenannte „Frankfurter Häuserkampf“ richtete, bei der es gewaltsame Demonstrationen gegen eines seiner Häuser im Frankfurter Westend gab. An dem Protest von ca. 1000 Mitgliedern der jüdischen Gemeinde gegen die Aufführung des Stückes zehn Jahre später vor dem Theater nahm ich selbst teil, während ca. 30 Personen die Bühne besetzten. Bei den Straßenkämpfen herrschte geradezu eine Pogromstimmung, zu der Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit beitrugen, die sich später bei dem Ziel ihrer Angriffe, Ignatz Bubis, entschuldigten.
Doch nun zum Faktencheck.
Waren die Juden immer wirklich so reich und einflussreich, wie man ihnen nachsagt? Um das Gegenteil zu beweisen, reicht ein Blick auf die Fotografien der jüdischen Viertel im Osteuropa der Vorkriegszeit, bis hin zu literarischen Zeugnissen und Dokumenten. Aber auch die Fachliteratur gibt dazu reichlich Auskünfte. In dem im Jahre 2000 im Auftrag des Dubnow-Instituts von S. Jersch-Wenzel herausgegebenen Buch „Juden und Armut in Mittel- und Osteuropa“ wird die Situation der Juden beleuchtet, in der „Armut eine stets präsente und im Hinblick auf Osteuropa sogar dominante Grunderfahrung jüdischer Existenz war.“ Dort heißt es auch „Der Stereotyp des reichen Juden ist sogar unter Historikern verbreiteter als der des armen Juden.“
Arme Juden als soziale Kategorie
Eine Schicht von armen Juden gab es schon seit dem Mittelalter, sie wurden „Schalant-Juden“ genannt und von der jüdischen Fürsorge betreut. Wer es nicht war, wurde zum Betteljuden und nicht selten zum jüdischen Delinquenten, deren Erwerbsarten sowohl der innerjüdischen wie der außerjüdischen Obrigkeits- und Rechtssphäre nicht entsprachen. Dabei ist die Zedaka, die Wohltätigkeit, ein ethisches Gebot im Judentum, den Armen zu helfen. Dieses Gebot gäbe es logischerweise gar nicht, wären alle Juden reich.
Dass es arme Juden gibt, wissen wir alle aus dem seit 1968 auf deutschen und internationalen Bühnen bis heute erfolgreichen Musical „Anatevka“, der deutschen Version des Broadway-Schlagers „Fiddler on the Roof“, nach dem Klassiker der jiddischen Literatur „Tewje, der Milchmann“ von Scholem Alejchem. Sein Titelsong „Wenn ich einmal reich wär‘“ spiegelt die Träume der armen Juden wie Tewje, einmal wohlhabend wie „Rotschschild“ zu sein. Dieser legendäre Name war der Inbegriff des „reichen Juden“, des einzigen weit und breit, der dem allgemeinen Elend der Ostjuden im Ansiedlungsrayon wie ein Lichtstrahl erschien.
Die Lage in Polen
Im 16. Jahrhundert erblühte die jüdische Wissenschaft und Kultur unter der Krone Polens. Ausgewählte Juden waren traditionellerweise Mittler zwischen dem Adel und dem Volk, handelten mit Rohstoffen oder verwalteten die Güter – was aber Mitte des 17. Jahrhunderts mit dem Chmelnitzki-Aufstand und den Kosaken-Massakern an etwa 200.000 Juden Osteuropas zu Ende ging. Der mystische Chassidismus war eine Volksbewegung, die als Reaktion der verarmten Juden auf die bedrohlichen Umstände entstand. Die Teilungen Polens am Ende des 18. Jahrhunderts führten die Juden des Landes unter unterschiedliche Herrschaftssysteme. Die Mehrheit der Juden – ca. 5 Millionen – lebte in Ostpolen und geriet unter russische Herrschaft. Die Zarin Katharina die Große beschränkte deren Wohnrecht auf den von ihr angeordneten Ansiedlungsrayon, in den die Juden umgesiedelt wurden. Sie strebte zwar an, ihre jüdischen Untertanen zu Bürgern zu machen, dabei verloren aber viele ihre Existenzgrundlage. Die jüdische Aufklärung, die in Osteuropa später einsetzte als im Westen, brachte – neben der Assimilation – neue Impulse für die jüdische Gesellschaft. Die weltliche Kultur zog ein und damit neue Erwerbsquellen: Das jiddische Theater entstand, die Juden waren nun auch auf den Bühnen zu sehen, säkulare Literatur wurde geschrieben, jüdische Komponisten betraten die Konzertsäle, doch auch sie waren nicht reich.
Galizien, das nach der Teilung zum österreichischen Teil Polens gehörte, war Schauplatz zahlreicher Taufen und der Germanisierung. Durch Auswanderung nach Wien oder gar weiter westwärts nahm die jüdische Bevölkerungszahl ab. Von der einsetzenden Industrialisierung konnten prozentual nur wenige Juden als Unternehmer und Fabrikbesitzer profitieren und zu Reichtum gelangen.
Im Preußischen Teil Polens gewann die aus Berlin des Moses Mendelssohn ausgehende aufklärerische Haskala-Bewegung an Einfluss. Es entstand eine jüdische Reformbewegung, die nicht selten zur Taufe führte und wie bei Heinrich Heine als „Entreebillet in die europäische Kultur“ diente. Vor der Emanzipation konnten nur die getauften Juden studieren und so ihren Lebensstandard heben. Jüdische Bildung gepaart mit weltlicher trug erstaunliche Früchte und die neue Schicht konnte einen gewissen Reichtum erlangen und so der Armut entfliehen. Einzelne von ihnen wurden Universitätsprofessoren, Ärzte, Juristen und Verleger. Diese wenigen „Reichen“ genügten jedoch, um den Judenfeinden Argumente zu liefern und „Fake-Nachrichten“ über deren angeblich schädlichen Einfluss auf die Mehrheitsgesellschaft zu verbreiten. Ein Opfer solcher antisemitischer Hasskampagnen wurde u.a. der Berliner Jude Walther Rathenau, Großindustrieller, Schriftsteller und liberaler Reichaußenminister, was zu dessen Ermordung im Juni 1922 führte.
„Reich wie Rotschild“
Die Frankfurter Rothschild-Familie war für die zerlumpten Juden im fernen Osteuropa eine Märchenfigur. Sie kannten nur wenige reiche Juden in ihren Schtetln und Dörfern, denn die Mehrheit war bitterarm. Der Milchmann Tewje, ein moderner Hiob, Vater von sieben schwierigen Töchtern, die alle eine Mitgift brauchten, um eine gute Heiratspartie zu sein, gehörte zu der Mehrheit der Schtetljuden. Diese arbeiteten, wenn männlich, als fahrende oder kleine Waren-Händler, Musikanten (Klesmer), Unterhalter (Badchonim), Flickschuster, Uhrmacher, Kutscher, Schneider, Schreiber, Weber, Bäcker, Schnorrer, Fischverkäufer, seltener Pächter von Land oder Schenken, Viehhändler, dafür Lumpensammler, Schächter, Wasserträger, Teppichklopfer, Kaminfeger und Schmiede. Die Gebildeten unter ihnen waren als Melameds, die Elementarlehrer der kleinen Kinder im Cheder, Buchhändler sowie Rabbiner und Heiler tätig. Die Frauen waren Mütter, Federzupferinnen, Wäscherinnen, Büglerinnen, Krämerinnen, Näherinnen, Spinnerinnen und – wenn es gar nicht anders ging, auch Prostituierte, denn in der jüdischen Unterwelt gab es neben den ganz Frommen auch die sehr Profanen, Zuhälter und Diebe. Das Geschäft war oft Teil der Wohnung, in der die Großfamilien kaum Platz hatten. Das jüdische Proletariat, zu sehen auf den Fotos von Roman Vishniac („Kinder einer verschwundenen Welt“) oder Alter Kacyzne („Poyln. Eine untergegangene jüdische Welt“), war weder gebildet noch hatte es eine Berufsausbildung.
Die zerrissenen Kleider und das zerschlissene Schuhwerk der Menschen auf den Fotos zeugen davon – ob in Galizien oder auf der Krochmalnastraße in Warschau, die im Werk von Isaac Bashevis Singer, immerhin dem Sohn eines Rabbiners, verewigt wurde:
„Unsere Wohnung war immer nur halb eingerichtet. Vaters Arbeitszimmer enthielt keine Möbel, bloß Bücher. Im Schlafzimmer standen zwei Betten, das war alles. Mutter hielt nie Vorräte in der Speisekammer. Sie kaufte immer nur das ein, was sie gerade für den Tag brauchte, und zwar meistens deshalb, weil ihr Geld für mehr nicht reichte.“
Verlassene Ehefrauen
Wenn das Dasein unerträglich wurde und man etwas Gespartes besaß, emigrierte einer oder die ganze Familie nach Amerika und versuchte, in den berüchtigten Sweat Shops an der Lower East Side New Yorks etwas von dem erträumten Geld als Anfang vom Reichtum zu verdienen, das in der „goldenen medine“, dem neuen Gelobten Land, angeblich auf der Straße lag, wie die Legenden um die Emigrierten versprachen. In Osteuropa blieben oft Frauen mit ihren Kindern allein zurück, wenn der Ehemann als erster zur „Rothschild-Laufbahn“ aufbrach und von Manchem dann nicht selten nie wieder etwas zu hören war. Die verlassenen Frauen ohne Scheidungsurkunde, das Get, konnten nicht neu heiraten, verarmten vollends und waren auf die Gemeinde-Fürsorge oder die Gnade der Verwandtschaft angewiesen.
Die „Schtetls“ im Westen
Die Armut des Schtetls blieb nicht nur auf den russischen Ansiedlungsrayon beschränkt. So lebten zum Beispiel Juden, trotz der wiederholten Verfolgungen und Vertreibungen bis zum Anschluss 1938 in der NS-Zeit immer wieder auf der „Mazzeinsel“ im Wiener 2. Bezirk, der Leopoldstadt. In Wien wohnten bis 1938 insgesamt 200.000 Juden, ein Drittel von ihnen auf der Mazzeinsel. Sie waren mehrheitlich religiös (daher der Ortsname), viele stammten aus den Ostgebieten und waren bitterarm, insbesondere die Kriegsflüchtlinge nach 1914 – viele waren arbeitslos. Bis 1945 wurden 65.000 Wiener Juden ermordet, der Rest konnte emigrieren. Viele waren Musiker, Literaten, Schriftsteller und Künstler, auch Geschäftsleute – aber allesamt keine Rothschilds.
In Paris gab es das Pendant dazu, das „Pletzl“ im Marais, dem ehemaligen Sumpfgebiet, wo sich Juden seit dem 13. Jahrhundert, wiederum trotz Verfolgungen und Vertreibungen immer wieder ansiedelten. La Rue des Rosiers war die pulsierende Lebensader des Viertels. In Frankreich lebten Anfang des 21. Jahrhunderts noch 800.000 Juden, deren Zahl sich aber aufgrund des erneut um sich greifenden vielfach von der muslimischen Gemeinschaft ausgehenden gewalttätigen Antisemitismus inzwischen reduziert hat. Eine bunte Mischung aus nordafrikanischen Sepharden und Einwanderern aus Ost- und Mitteleuropa bevölkerten die Straßen mit Bäckereien, Judaica-Läden, Buchantiquariaten, Galerien, und dem Museum für jüdische Kunst. Aber seit 1982 ein Bombenattentat von „Palästinensern“ sich gegen das koschere, weltweit bekannte Restaurant Goldenberg richtete, bei dem 6 Menschen getötet und 22 verletzt wurden, verschlechterte sich die Stimmung dort von Jahr zu Jahr, und die Anschläge der letzten Jahre wie das auf den jüdischen Supermarkt „Hyper Casher“ führen zu einem nicht endenden Exodus französischer Juden nach Israel.
Gegenwärtig ist ein besorgniserregendes allgemeines Wiedererstarken des Antisemitismus in Europa zu verzeichnen. Die alten, „klassischen“ Hassparolen und Vorurteile, wie die des reichen machtgierigen Juden, werden mit neuen Elementen des israel-bezogenen Antisemitismus „angereichert“, so dass ein explosives Gemisch entstanden ist, das die Zukunft des jüdischen Lebens in Europa in Frage stellt. Dass nun im 21. Jahrhundert Juden sogar in deutschen Medien immer noch dämonisiert werden, straft eine Gesellschaft Lügen, die sich selbst gerne offen, menschenfreundlich und tolerant nennt.
Die Antisemitismusbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen sowie die Anti-BDS-Resolution des Deutschen Bundestages sind eine erste positive Antwort auf die Alarmsignale, aber keine Lösung. Doch die besorgte Frage „Quo vadis, Europa?“ wird die Juden des Kontinents noch lange beschäftigen und eine beruhigende Antwort ist nicht in Sicht.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung
Menschen und Wissen