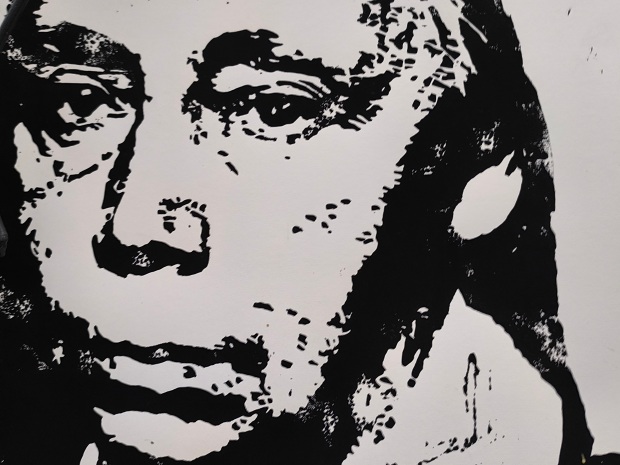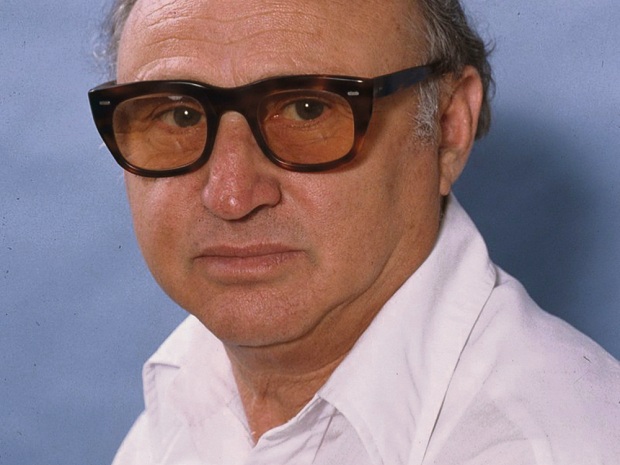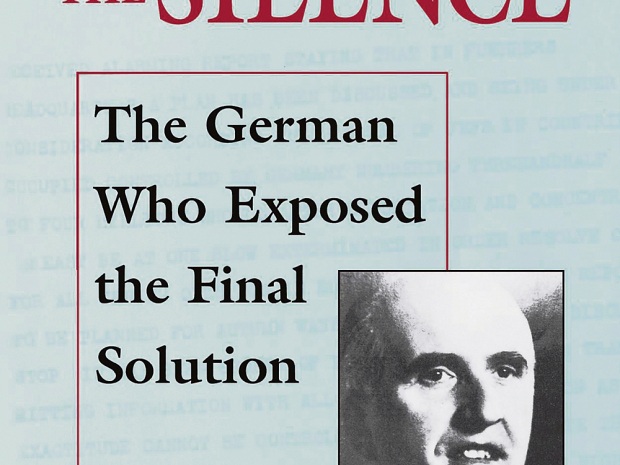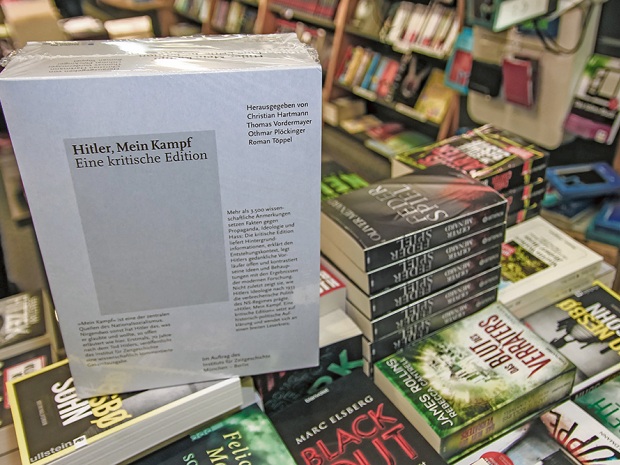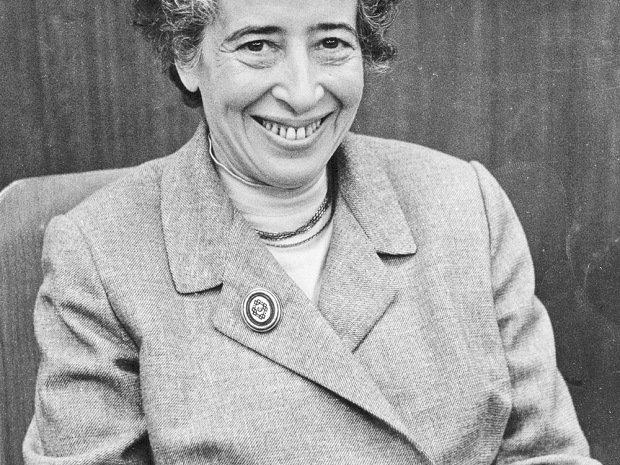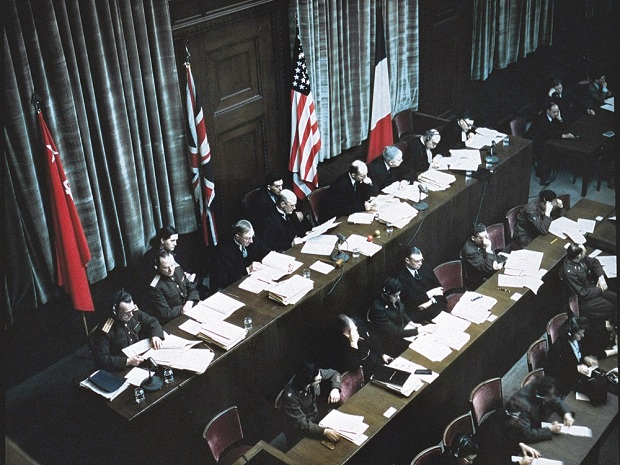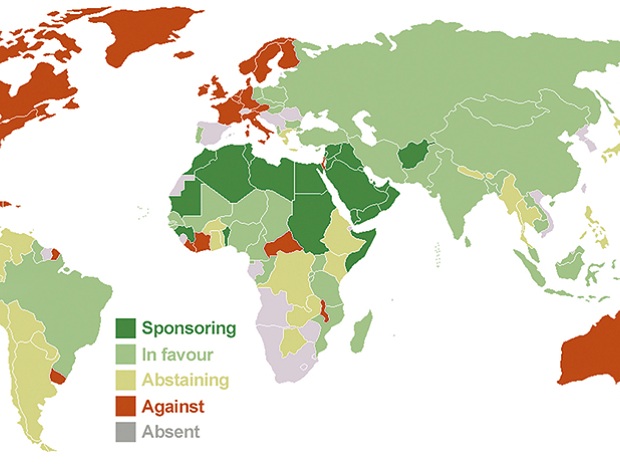Zum Gedenken an das Massaker von Babi Jar

Der amerikanische Journalist Eddie Gilmore fügte als Illustration für seinen im Mai 1944 im National Geographic Magazine veröffentlichten Artikel über die Befreiung der Ukraine ein Foto bei, das er im November 1943 in Babi Yar aufgenommen hatte
Am 29. und 30. September 1941, dem damaligen Yom Kippur Tag, ermordeten Einsatzgruppen der SS unter Mithilfe örtlicher ukrainischer Polizeikräfte und der bis heute mit Straßennamen und Denkmälern in der Ukraine geehrten nationalen ukrainischen Organisation der Nazi-Kollaborateure Stepan Bandera und Andriy Melnyk bei der größten brutalen Ermordung und Massenexekution im Zweiten Weltkrieg mehr als 30.000 jüdische Kinder, Frauen und Männer. In der Schlucht von Babi Jar in der Nähe von Kiew wurden die jüdischen Menschen mit freiwilliger ukrainischer Mittäterschaft der oben genannten Kollaborateure zusammengetrieben und dann kaltblütig erschossen oder lebendig in die Schlucht geworfen. Kleine Kinder wurden häufig von den Nazis und den ukrainischen Mordhelfern aus den Armen der Mütter entrissen und in die Schlucht geworfen oder unsäglicherweise noch auf den Armen der Mütter erschossen. (JR)
Gleich nach der Befreiung Kiews kamen die Bewohner der Vorkriegszeit, darunter auch Juden, hierher. Aber wie sehr hat sich die Stadt verändert! Und es waren nicht nur die Ruinen und die Entvölkerung, die sie zu diesem Zeitpunkt bereits hinter sich hatte. Auch die Abwesenheit von Juden in der Stadt war unübersehbar. Aber nicht nur das: Die Rückkehr der überlebenden Juden war hier nicht willkommen!
Am 7. November 1943 schrieb Mordechai Brodsky, Bürger von Kiew, seiner Frau Nina in der Evakuierung, was er erlebte, als er von der Befreiung Kiews erfuhr: „Es gibt einfach keine Worte, um die Freude auszudrücken, die ich im Zusammenhang mit der heutigen Befreiung Kiews empfinde. Ich hätte nie erwartet, dass meine Heimatstadt so bald befreit werden würde. Heute habe ich mehrere Briefe nach Kiew geschrieben, an meinen Vater, obwohl ich nicht erwarte, eine Antwort von ihm zu erhalten; ich habe auch an die Hausabteilung und an Perepidina geschrieben, die ein Stockwerk unter uns wohnte, und ich weiß nicht, an wen ich noch schreiben soll, denn ich weiß, dass alle weggegangen oder umgekommen sind... Nina, wenn du auch nur die Möglichkeit hast, nach Kiew zu gehen, tu es nicht, sondern überlege es dir und entscheide nach deinem Verständnis. Denn es ist eine ernste Angelegenheit, sowohl in Bezug auf die Wohnung als auch auf die Arbeit und den Winter, aber wie auch immer du dich entscheidest, ich werde deine Entscheidung trotzdem gutheißen...“.
Was steckt hinter der Angst, die in diesem Brief so deutlich spürbar ist? Angst vor der Konfrontation mit der zu erwartende brutale Wahrheit über das Schicksal von Familie und Freunden? Oder intuitive Unsicherheit über die eigenen Aussichten in der Heimatstadt, die vielleicht noch immer judenfeindlich ist? Oder vielleicht beides...?
Im Sommer 1944 hatte die Schlucht bereits den Status eines inoffiziellen Wahrzeichens der Stadt erlangt. Die „Führer“, die die Abwesenheit der Juden feststellten, waren Ukrainer, die noch immer die Fähigkeit besaßen, Juden und Nicht-Juden eindeutig zu unterscheiden.
Der Militärarzt Gutin erinnert sich: „... Ich kam am 15. April 1944 mit dem Militärkrankenhaus, in dem ich arbeitete, in Kiew an. Vom Bahnhof aus ging ich direkt nach Babi Jar. Irgendwo auf dem Weg bemerkte ich zwei Ukrainer, die mich aufmerksam ansahen. Dann sagte der eine zum anderen: „Schau mal, Gavrila, ein echter Jude. Wir haben seit drei Jahren keinen echten mehr gesehen.“
In der Nähe von Babi Jar stand ein Ukrainer an dem Stand, den er gebaut hatte, wie ein kundiger Führer erzählte er den Juden um ihn herum, was er gesehen hatte, und um die Wirkung zu verstärken, zündete er ein Feuer am Grund der Schlucht an, so dass man die Asche sehen konnte. Die Leute um ihn herum lauschten gierig jedem seiner Worte, in der Hoffnung, wenigstens etwas über ihre Verwandten und Freunde zu erfahren.
Auf der anderen Seite der Schlucht erzählt uns ein jüngerer Ukrainer ebenfalls sehr anschaulich: „Eine Frau warf ihr Kind den in der Nähe stehenden Ukrainern zu, woraufhin die Deutschen es bemerkten, wegnahmen und in die Schlucht warfen“.
Der erste Gedenktag
Der 29. September ist der Gedenktag für Babi Jar, der Jahrestag des unschuldigen Todes seiner Opfer. An diesem Tag sollen Kerzen angezündet und das Kaddisch zum Gedenken an sie rezitiert werden. Der 29. September 1944 ist der dritte Jahrestag der Hinrichtung der Juden in Babi Jar und der erste Tag, an dem es möglich wurde, die Gedenkfeier zu begehen. Von diesem Datum an begann die Tradition, sich an diesem Tag in Babi Jar zu versammeln und der Toten zu gedenken.
David Hofshtein, ein Dichter und Mitglied des YAC, der zu diesem Zeitpunkt nach Kiew zurückgekehrt war, versuchte erfolglos, eine Kundgebung in Babi Jar zu koordinieren. Das Verbot der Gedenkfeier in Babi Jar ist auch in Ehrenburgs Notizbuch vermerkt - in einer Notiz vom 8. Oktober 1944. Dennoch versammelten sich an diesem Tag viele Menschen ungefragt in der Schlucht, darunter auch Hofshtein selbst und sein Bekannter Itzik Kipnis.
Alexander Shlaen, der an diesem Tag - dem 29. September 1944 - nach Kiew zurückkehrte, erinnerte sich folgendermaßen: „...Direkt vom Bahnhof gingen wir zu unserer Tarasowskaja-Straße. Das Haus war niedergebrannt. Wir standen vor dem neunstöckigen Rohbau. Wir erinnerten uns an diejenigen, die vor drei Jahren hier zurückgelassen wurden. Und dann gingen wir nach Babi Yar.
- Mein Sohn, - sagte meine Mutter, - ich möchte, dass du dich für immer an diese Straße erinnerst... Und denke immer an diejenigen, die sie passiert haben....
Wir liefen lange Zeit... Wir kamen zum jüdischen Friedhof. Wir konnten die Gräber von Mamas Eltern kaum finden. Alles um sie herum war verwüstet... Es gab keine Denkmäler. Auch auf den Nachbargräbern gab es keine. Viele Jahre später erfuhr ich, was die Faschisten hier auf dem Friedhof an Marmor- und Granitgrabsteinen angebracht hatten.
Dann verließen wir den Friedhof und liefen in Richtung Babyn Yar. Ein endloser Strom von Menschen bewegte sich den schmalen Pfad entlang, der dorthin führte. Dort, in der Nähe der Grube, waren viele Menschen versammelt. Viele trugen Militäruniformen. Einige warfen Blumen direkt von den Hängen in die bodenlose Grube. Andere legten Blumen am Rande der steilen Klippen nieder. Und alles in Stille, Stille. Nur hin und wieder durchbrach das Schluchzen eines Menschen diese schreckliche Stille. Es schien, als hielten die Menschen sogar den Atem an, als hätten sie Angst, die Ruhe der Toten zu stören.
Plötzlich ertönte tief unten, irgendwo auf dem Grund des Lochs, eine Art Schrei, unmenschlich. Wir rannten zu der Stimme. Dort stand eine Gruppe von Menschen. In der Mitte stand eine kleine, blonde, junge Frau. Sie schluchzte und drückte etwas an ihre Brust.
- Liza, Liza, meine Schwester! - Durch ihr ersticktes Schluchzen hindurch wimmerte sie. In ihren Händen hielt sie einen Schädel, umhüllt von einem dunkelblonden Zopf, der mit einem großen Kamm befestigt war. An diesem Zopf, an dem Wappen mit den Initialen ihrer Schwester, erkannte sie, was von ihrer Schwester übrig geblieben war.
Ein Militärangehöriger mit einer Arztweste näherte sich. Er schaute sich den Schädel an. Er sagte, dass die Verstorbene allem Anschein nach nicht älter als 17 oder 18 Jahre alt gewesen sei. Die Frau, die dieser schreckliche Fund nicht losließ, holte ihren Reisepass aus der Tasche und reichte ihn den Leuten. Sie konnte kein Wort aus sich herausbringen. Und alle sahen es - 1941 war sie, wie ihre Zwillingsschwester, 17 Jahre alt. 1941 war es unmöglich, aus Babi Yar zu entkommen. Nur wenige Menschen überlebten wie durch ein Wunder. Einige wenige unter Zehntausenden. Diese Frau war eine von ihnen.
Der Schädel wurde hier begraben. Und sofort wuchs ein Berg von Blumen über dem winzigen frischen Hügel. Jeder begrub in diesen Minuten nicht nur die sterblichen Überreste des unbekannten Mädchens Lisa, sondern auch seine Verwandten, seine Lieben. Meine Mutter und ich standen in einiger Entfernung. Wir hatten keine Kraft, hier wegzugehen. Und die Leute kamen immer wieder... Als sie erfuhren, was vor sich ging, legten sie schweigend Blumen auf ein frisches Grab von 1941. Ich konnte diesen Schrei noch viele Jahre lang hören.“
Traurige Erinnerungen
Am 29. September besuchte Sarra Tartakovskaya Babi Jar: „...Wir kehrten von der Evakuierung 1944 nach Kiew zurück. Am dritten Jahrestag des Todes meines Vaters, meiner Mutter, meiner Schwester und meiner Verwandten, dem 29. September, kamen wir an den Ort ihres Todes, stiegen hinunter auf den Grund. Wir sammelten verbrannte Knochen von Händen, Beinen, aus dem Abhang zog ich an den Haaren (sie hatten keine Zeit zum Verbrennen) den Kopf eines Mädchens mit einem getrockneten Rest eines Taschentuchs, zwei Zöpfen, zwei Haarnadeln, einem Loch in der Schläfe heraus. Ich stand da und weinte: es hätte meine Schwester sein können.
Ein Mann kam auf mich zu, hob sanft meine Hände mit dem Kopf des toten Mädchens und rief laut: „Leute, vergesst das nicht.“ Er machte ein Foto von mir.
Und heute fällt es mir schwer, darüber zu schreiben. Wir sammelten einen Berg von Knochen und begruben sie in der Nähe des Hauses des Rabbiners, nicht weit von Jar. Während des ganzen Jahres 1944 ging ich jeden Tag nach Babi Jar, wir vergruben und vergruben die Knochen. Dann fingen sie an, den Müll dorthin zu bringen, und es lagen noch viele Knochen darunter“.
Der Schriftsteller Itzik Kipnis, der Anfang 1944 aus der Evakuierung nach Kiew zurückkehrte, besuchte denselben Ort: „...Heute ist der 29. September. Aus allen Teilen der Stadt kommen die Menschen nach Babi Jar... Vier Jahre sind vergangen, seit wir nicht zu Hause waren. Und nun treffen wir uns alle an diesem traurigen Tag in dieser traurigen Prozession.....
Irgendwo tief im Bewusstsein ist der Gedanke, dass sich jeder von uns in aller Ruhe und ohne unnötigen Aufmarsch und Lärm auf den Weg zu seinem verlassenen Nest gemacht hat ... Es ist jedem klar, dass jeder seinen eigenen Sack voller Sorgen und Kummer hat, der nach und nach abgeladen werden sollte...“.
Aber wie schwierig ist das! Die Tragödie ist zwar allgemein, aber jeder hat seine eigene Tasche: „...Wir nähern uns den Vorstädten. Gruppen von Menschen nähern sich aus verschiedenen entfernten Straßen, und wir erkennen uns gegenseitig. Diejenigen, die den Weg nicht kennen, fragen nicht, denn sie sehen, dass alle in diese Richtung gehen.
Und wenn wir auf die sonnenbeschienene Straße schauen, wird uns immer klarer: Es gibt viele Frauen und wenige Männer. Kein Wunder - der Krieg ist noch nicht vorbei, obwohl er sich dem Ende nähert. Und für uns ist es ein großer Trost und Stolz, dass unsere jungen Männer und Jungen in den Mänteln der Roten Armee den Feind besiegen ...
Die Menschen halten zusammen, sie reden nicht viel. Man schaut in die faltigen Gesichter und sieht, wie viel Kummer Hitler jedem von uns gebracht hat. Man beginnt zu begreifen, dass die Trauer eines jeden zum Vorschein kommen wird, sobald der Knoten der Geduld gelöst ist. Aus der Richtung von Jar kommen bereits Schluchzer. Die Gesichter der Menschen verfinstern sich und werden immer angespannter. Die Schwächeren können sich nicht zurückhalten, sie schreien und schluchzen jämmerlich. Die sandigen Klippen bröckeln unter unseren Füßen und ziehen uns hinunter ...
Wo sind wir hier? Ist das der Ort?! Meine Knie geben nach.
Zeugnisse der Qual
Viele Menschen haben sich bereits versammelt. Es sind diejenigen, die vor uns gekommen sind. Aber niemand hier sagt: „Guten Morgen!“ Und wenn jemand aus Versehen einen Gruß sagt, bekommt er keine Antwort... Unsere Herzen sind vereint, und unsere Blicke sind auf eine große bewachsene Fläche gerichtet, die die Form einer viereckigen Schale hat... Wir sehen ein zerknittertes und geschwärztes Stück weißen Stoffes an einer niedrigen Stelle liegen. Es war einmal ein Hemd... Strähnen von Haaren, eine alte Mütze, Fetzen von ausgerissenen Bärten zusammen mit getrockneter Haut - all das sieht gruseliger aus als der Tod.
Fast in der Mitte steht ein zertretener Schuh, der in jenem letzten unvorstellbaren Moment vom Fuß fiel, den Sie und ich nicht erlebt haben, und deshalb kann kein Wort von uns beschreiben, wie es war; ein Schuh, mit dem der stolpernde Fuß in dem Moment auseinanderging, als der Körper selbst im Kessel des Todes und der schrecklichen Schreie vom Leben Abschied nahm. Niemand berührt den Schuh, niemand berührt ihn... Auch nicht das Schädelfragment am anderen Ende der Grube. Ein Knochenstück, auf der einen Seite kahl, auf der anderen Seite mit verschrumpelter Haut und Haaren bedeckt. Es streicht wild gegen den Himmel mit einem lebendigen Vorwurf, dieses Fragment eines gesegneten menschlichen Körpers, dieser Bote von Babi Yar, Zeuge einer gequälten Gemeinschaft, von Hunderttausenden von Opfern. Er klagt an und verlangt Rechenschaft, lässt keine Kompromisse zu und erwartet keine Gnade.
„Auch mein Herz ist voller Tränen, aber ich weiß auf jeden Fall etwas, das ich offen sagen kann:
- Meine Brüder und Freunde, wir fallen mit dem Gesicht auf den Boden, bestreuen unsere Köpfe mit Asche, schlagen uns hysterisch. Wir weinen und schluchzen. Und kann es anders sein? Und kann jemand kommen und sagen, dass wir uns zu sehr dem Kummer hingeben, dass wir uns zu sehr quälen, dass wir uns zerreißen und unsere Gesichter in Blut auf den Dornen (die wild an den Seiten des Grabens wachsen) zerreißen, sie bis zum Schmerz zerreißen, bis zum Schreien?
Und doch, meine Blutsbrüder, möchte ich zu jedem von euch sagen:
- Juden, meine Lieben, erheben wir uns vom Boden, schütteln wir die Asche unserer Opfer ab, strahlen wir mit jenem besonderen Licht, das unser Volk in sich trägt! Ein Mensch, dem ein Bein oder eine Hand, ja sogar ein Finger abgenommen wurde, fühlt sich bereits minderwertig, gedemütigt....
Aber das Volk... Ein Volk, dem die Hälfte oder sogar drei Viertel seines Körpers genommen wurde, wie es uns passiert ist, ein Volk ist wie ein Wassertropfen oder eine Quecksilberkugel in der Lage, sich wiederherzustellen. Nimm einen Teil davon weg, und der andere Teil rundet sich sofort, füllt sich auf und wird ganz.
Lasst uns vom Boden aufstehen und unsere Fahne hoch tragen. Und ihr werdet sehen, wie die Menschen uns für unseren Mut, für unsere irdische Stärke respektieren werden“.
Erschütternde Erlebnisse
Die meisten, die auf dem Weg zum jüdischen Lukjanowsky-Friedhof nach Babi Jar kamen, sahen, wie dieser gelitten hatte - halb zerstört, halb in völliges Chaos verwandelt. Anatoli Kusnezow hat es folgendermaßen festgehalten: „Es gab buchstäblich kein einziges unzerstörtes Denkmal, keine Gruft und keine Grabplatte mehr. Es schien, als ob ganze Kompanien auf den Friedhof gingen, um Schießen und Gewichte heben zu üben. Nur ein großes, noch nie dagewesenes Erdbeben konnte eine solche Zerstörung verursachen. Der Friedhof war riesig und zeichnete sich durch eine außergewöhnliche Vielfalt an Denkmälern und malerischen Ecken aus... Die letzten Daten der Bestattungen wurden 1941 abgeschnitten, aber auf einigen, sehr seltenen Gräbern gab es bereits erkennbare Restaurierungsversuche: getrocknete Fäkalien wurden abgekratzt, eine rissige Platte wurde ungeschickt mit Zement geklebt, verwelkte Blumen lagen dort“.
Der Kiewer Shimon Chervinsky befand sich buchstäblich am Tag der Befreiung, dem 6. November 1943, in seiner Heimatstadt: „Der Tag war bedeckt, es nieselte feiner Regen. Es gab nur wenige Menschen. Nur einige wenige Militärs liefen in der Asche herum. Und es herrschte eine schreckliche Stille. Es war eine echte Asche. In der Asche lagen zerbrochene Gitterstäbe von Grabzäunen, Knochen von Erwachsenen und Kindern, Schädel, halb verfaulte Kinderschuhe. Ich wanderte zwischen den zerbrochenen Denkmälern des Friedhofs umher, die von wildem Gebüsch überwuchert und mit abgefallenen Blättern bedeckt waren. Als es anfing, dunkel zu werden, ging ich weg. Ich bin kein Schriftsteller. Ich kann die Situation und meine Gefühle nicht in Worte fassen, und ich werde es auch nicht tun, aber das Bild dieses Tages ist mir immer vor Augen geblieben...“.
Der Schriftsteller Alexander Burakovsky beschrieb in seinem Artikel „Die Erinnerung ist nicht für die Toten...“ seine Eindrücke aus der Kindheit: „Die Angst vor dem ersten Besuch in Babi Jar im Frühjahr 1944 blieb in meinen Kindheitserinnerungen.... An diesem Tag nahm mich mein Vater mit ... Die steilen Schluchten waren mit dornigem Gebüsch bewachsen. Ich lief die gewundenen Pfade entlang... Mein Vater ging langsam, seine rechte Hand bewegte sich noch nicht. Er ging - und weinte... Ich habe ihn nie wieder weinen sehen. Sein älterer Bruder mit seiner Frau und seinen fünf Töchtern, seine ältere Schwester mit ihrer Familie und andere Verwandte wurden in diesen Gruben begraben. Es war sehr kalt auf dem Grund der Schlucht, die von den Regenfällen aufgerissen und ausgehöhlt worden war. Und unheimlich, wie in einem feuchten Kerker ... Später, als ich bereits wusste, was Babi Jar war, und gelegentlich allein hierher kam, fand ich an verschiedenen Enden der Schluchten fast immer kleine Sträuße mit Wildblumen, einige Chrysanthemen, manchmal rote Rosen, vertrocknet und manchmal frisch, als ob sie zufällig und unbemerkt heruntergefallen wären.“
1949 war der 20-jährige Roman Levin, der einzige Jude, der das Ghetto von Brest überlebt hatte, in Kiew, in der Nähe von Babi Jar. Er war beeindruckt von dem, was er sah: „Die Tatsache, dass es an diesem Ort keinen Grabstein gibt, ist nichts. Sie hatten keine Zeit, ihn aufzustellen oder etwas anderes. Aber was sich vor meinen Augen abspielte, war entsetzlich und machte mich fassungslos. Vom Rand der Schlucht aus und weiter in die Tiefe der Hinrichtungsstätte - eine Müllhalde, ein Berg von Unrat: verrottete Lumpen, Dosen, Flaschen. Mein Onkel und ich erstarrten in Verzweiflung, mit gesenktem Kopf, als ob vor unseren Augen die von den Nazis ermordeten Menschen, das menschliche Gedächtnis, das Mitgefühl, die Vernunft und das Gewissen der Lebenden erschossen würden“.
Auszug aus dem Buch „Babi Yar. Realitäten“. Veröffentlicht mit Abkürzungen.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung