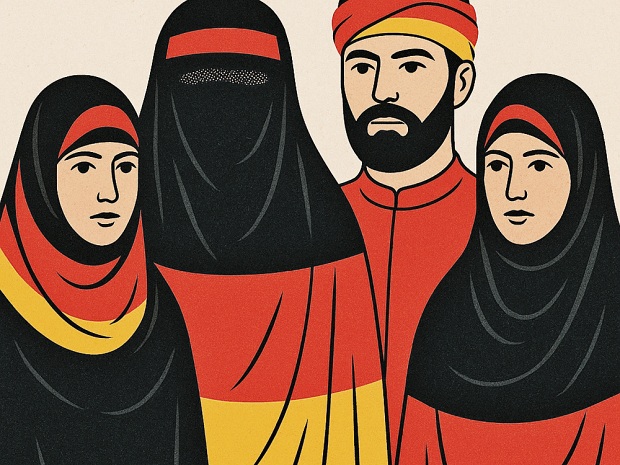Honig, Geschichte und Hoffnung – Nürnbergs erster koscherer Lebkuchen

„Shalom aus Nürnberg“© VITALI LIBEROV
Essen verbindet – und manchmal auch Geschichte. In Nürnberg, wo einst Synagogen brannten und jüdisches Leben ausgelöscht wurde, entsteht nun etwas Neues, das symbolischer kaum sein könnte: der erste koschere Nürnberger Lebkuchen. In Zusammenarbeit mit der Traditionsbäckerei „Lebkuchen Schmidt“ und dem „Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Nürnberg–Hadera“ wurde das süße Gebäck nach jüdischem Reinheitsgebot gefertigt – koscher und in Bio-Qualität. Dass ausgerechnet an diesem Ort, wo die Synagoge schon 1938 auf Geheiß Julius Streichers fiel, nun wieder koscher gebacken wird, ist mehr als ein kulinarisches Projekt: Es ist ein Stück gelebter Versöhnung.
Laut der Webseite der Firma „Lebkuchen Schmidt“ haben „schon die alten Ägypter Kuchen mit Honig bestrichen und zusammen gebacken“. Das gilt in der Zunft als Ursprung des Lebkuchens, der um 350 v. Chr. das erste Mal schriftlich erwähnt wird. Weiter heißt es dort:
„Nach der Mythologie der Ägypter, Griechen, Römer und Germanen war Honig eine Gabe der Götterwelt. Und auch in der Bibel ist die Rede vom ´gelobten Land, in dem Milch und Honig fließt`. So erklärt sich, dass man in alter Zeit dem Honig als göttlicher Gabe dämonenvertreibende, heilende und lebensspendende Wirkung zugeschrieben hat. Ebenso sollten natürlich alle Speisen und Backwerke, die mit Honig zubereitet waren, diese Eigenschaften haben“.
Dem „Honig-Verband“ zufolge wird in der Bibel „das Land in dem Milch und Honig fließen“ 16-mal erwähnt. Hintergrund ist die Flucht des Volkes Israel vor den Ägyptern in die Wüste. Den Israeliten ist ein Land versprochen worden, das weit und schön ist, ein „Land, in dem Milch und Honig fließen“, deshalb ziehen sie dorthin, erobern dieses Land und verteidigen es“.
Gemeinhin wird davon ausgegangen, dass damit nicht wirklich Honig im Sinne eines Imkerei-Produktes gemeint ist, sondern einheimische süße Früchte wie beispielsweise Datteln. Doch diese Annahme ist falsch; tatsächlich wurde dort bereits vor 3.000 Jahren die Kunst der Imkerei betrieben – und zwar u.a. in der antiken Stadt Tel Rehov im Beth-Shean-Tal. Dort fanden Wissenschaftler bei Ausgrabungen im Jahr 2007 „ein vollständiges Apiarium, wie man ein Bienenhaus in Fachkreisen nennt, im Stadtzentrum. Es besteht aus beinahe einhundert zylindrischen Körben aus Stroh und Lehm. Sie sind teils sogar etagenweise übereinander gestapelt. Die größten von ihnen haben einen Durchmesser von 40 Zentimetern und sind fast einen Meter hoch. Die Auswertungen ihres Inhalts ergaben, dass sie tatsächlich als Bienenstöcke genutzt wurden.
Sie können diesen Artikel vollständig in der gedruckten oder elektronischen Ausgabe der Zeitung «Jüdische Rundschau» lesen.
Vollversion des Artikels
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Hier können Sie
die Zeitung abonnieren,
die aktuelle Ausgabe oder frühere Ausgaben kaufen
oder eine Probeausgabe der Zeitung bestellen,

in gedruckter oder elektronischer Form.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung