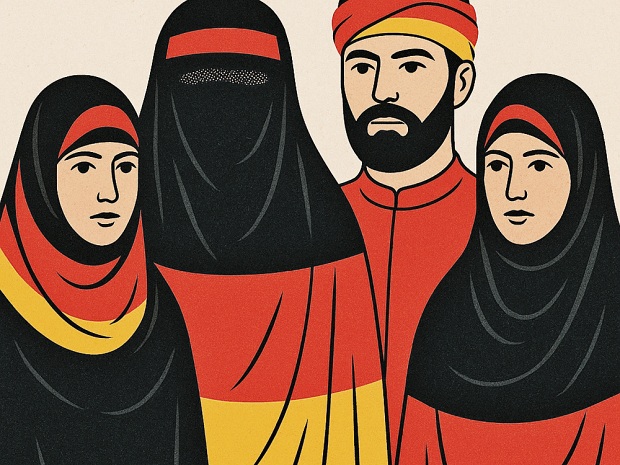Budapests Haus des Terrors – Bollwerk gegen das Vergessen

Das Museum „Haus des Terrors“ in Budapest. © AXEL SCHMIDT_AFP
Während die CDU mit judenfeindlichen Begriffskreationen wie etwa die Aussage von Johann Wadephuls „Zwangssolidarität“, die die Staatsräson zu Israel de facto aufkündigt, erinnert Ungarn an seine Geschichte mit Einsicht und Klarheit. Aus der Perspektive einer nationalkonservativen, stolzen Nation heraus, die eine Auseinandersetzung mit den Verbrechen beider mörderischer Diktaturen des 20. Jahrhunderts nicht scheut: dem faschistischen Terror der Nationalsozialisten und dem Terror der Kommunisten. Abseits von Kotaus vor islamischen Migrantenströmen, gleichzeitiger „Nie-Wieder“-Obsession und eliminatorischer „Israelkritik“, zeigt Ungarn mit dem „Haus des Terrors“, wie Gedenken ohne Zerstörung nationaler Identität, funktionieren kann. Auch mit der Wahl eines Neorenaissance-Palais als Ausstellungsort, das sich auf einem der schönsten Boulevards Budapests befindet, unweit der prachtvollen Staatsoper, umgeben von ausländischen Botschaften, ist Viktor Orban gleichermaßen ein Befreiungsschlag gegen die Verharmloser der stalinistischen Gulag-Gräueltaten und der ungarischen Nazi-Kollaboration sowie im geschichtspolitischen Diskurs gelungen. (JR)
Gedenken als nationalkonservatives Manifest
Mitten in Budapest, an der geschichtsträchtigen Andrássy út, erhebt sich ein Gebäude, das mehr als ein Museum ist. Es ist ein nationales Manifest. Das Haus des Terrors ist nicht nur Gedenkstätte für die Opfer zweier menschenverachtender Regime – des nationalsozialistischen und des kommunistischen –, sondern ein Ort, an dem Ungarn seiner eigenen Geschichte mit unerschrockener Klarheit begegnet. Es ist ein Ort, an dem Erinnerung nicht domestiziert wird, sondern unmissverständlich bleibt. Wo andere relativieren, benennt man hier. Wo anderswo das Weichzeichnen Mode geworden ist, wird in Budapest kantig erinnert – konkret, unbequem, aufrecht.
Die Entscheidung, das Museum gerade hier, im einstigen Hauptquartier der ÁVH, der kommunistischen Geheimpolizei, einzurichten, war ein Akt bewusster Symbolik. In denselben Räumen, in denen Oppositionelle gefoltert, inhaftiert und zur Kollaboration gezwungen wurden, begegnet man heute ihrer Geschichte – nicht steril hinter Glas, sondern spürbar, eindringlich und architektonisch raffiniert. Auch das Vorgängerregime, die faschistischen Pfeilkreuzler, hatte das Gebäude genutzt – und so wurde aus dem Ort des Terrors ein Ort des Erinnerns.
Sie können diesen Artikel vollständig in der gedruckten oder elektronischen Ausgabe der Zeitung «Jüdische Rundschau» lesen.
Vollversion des Artikels
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Hier können Sie
die Zeitung abonnieren,
die aktuelle Ausgabe oder frühere Ausgaben kaufen
oder eine Probeausgabe der Zeitung bestellen,

in gedruckter oder elektronischer Form.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung