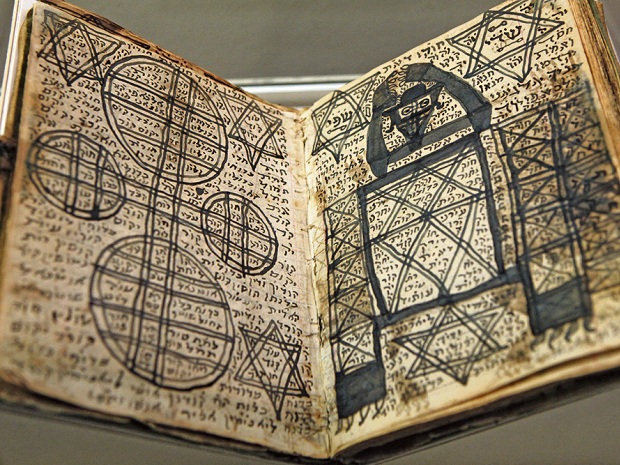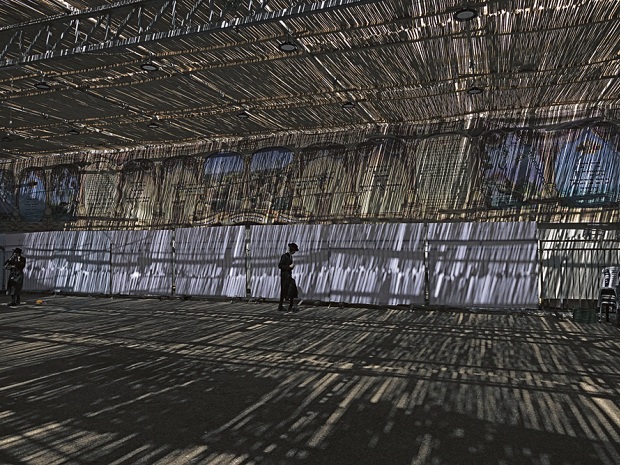10 Jahre Neue Synagoge Mainz
Das neue jüdische Gotteshaus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt ist eine architektonische Perle

Sehr modern kommt die Mainzer Synagoge daher.
Die Neue Synagoge Mainz steht nun bald seit zehn Jahren. Am 16. Oktober jährt sich das Richtfest entsprechend. Das Gemeindeleben hat seitdem einen deutlichen Aufschwung erlebt, wie Rabbiner Aharon Ran Vernikovsky feststellt. Zudem ist die Jüdische Gemeinde durch die Synagoge sichtbarer geworden – buchstäblich, aber auch metaphorisch.
Aktuell begeht die Jüdische Gemeinde Mainz/Worms die Jüdischen Kulturtage. Eine Veranstaltungs-Reihe, die sich von Anfang September bis Ende Oktober zieht. Lesungen, Ausstellungen oder Führungen gehören zum Programm. Sie entsprechen dem Geist, den Rabbiner Aharon Ran Vernikowsky mit dem Bau der Neuen Synagoge verbindet:
„Wir wollen als Jüdische Gemeinde den Dialog führen. Davon profitieren alle. Die nichtjüdische Gesellschaft erfährt etwas von jüdischem Leben und auch für uns ist es wichtig, uns zu öffnen.“
Die Alte Synagoge war in den Novemberpogromen 1938 vom braunen Mob zerstört worden. Von ihr blieb ein halbes Dutzend Säulen übrig. Nach dem Krieg entstand an der Stelle in der Mainzer Neustadt das Gebäude des Hauptzollamtes. Ein denkbar grober, hässlicher Klotz.
Es war vor allem das Engagement des damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck und des damaligen Mainzer Oberbürgermeisters Jens Beutel (beide SPD), die den Neubau an historischer Stelle vorantrieben. Unter anderem beteiligten sie sich als Schirmherren an der Gründung einer Magenza-Stiftung und organisierten politisch die rund 10 Millionen Euro, die für den Bau nötig waren.
Der geriet spektakulär. Der Architekt Manuel Herz orientierte sich am Jüdischen Museum in Berlin und schuf ein Werk, das in seiner Luftigkeit eine Wohltat für den Stadtteil ist – und in keinem größeren Kontrast zu dem Klotz stehen könnte, der die Lücke vorher besetzt hielt. Der Bau bildet die fünf hebräischen Buchstaben nach, die das Wort „Kaduscha“ formen.
Die Synagoge war so von Anfang an ein Hingucker. Ein Effekt, den Rabbiner Aharon Ran Vernikovsky als positiv bewertet:
„Schon allein dadurch, dass Menschen hier vorbeigehen und ihnen der Bau ins Auge fällt, wirft das Fragen bei ihnen auf: Was hat es mit dem jüdischen Leben zu tun, das sich dahinter verbirgt? So entsteht Interaktion. Und das ist gut so.“
In der Tat stieß die Neue Synagoge von Anfang an auf großes Interesse. Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Anna Kischner, erinnert zur Eröffnung der Jüdischen Kulturtage an den Tag der Offenen Tür, den die Gemeinde seinerzeit anbot: Der musste am folgenden Tag wiederholt werden – einfach weil das Interesse so groß war.
Gut 450 Menschen bietet der Veranstaltungsraum Platz. Die Möglichkeiten, die daraus entstehen, nutze die Gemeinde reichlich, berichtet Rabbiner Aharon Ran Vernikovsky: „Unser Angebot ist seitdem stärker geworden. Vielfacher. Seriöser. Und niveauvoller.“ Das wirke nach innen genauso wie nach außen: „Das Interesse an jüdischem Leben ist in der Region dadurch größer geworden.“
Der Rabbiner hält es für eine zentrale Frage, die Arbeit an solchen Angeboten zu stärken: „Ohne geistige Inhalte kann das Judentum in Deutschland keine Zukunft aufbauen.“ Geistige Inhalte seien der Schlüssel des jüdischen Lebens.
Sehr geehrte Leser!
Die alte Website unserer Zeitung mit allen alten Abos finden Sie hier:
alte Website der Zeitung.
Und hier können Sie:
unsere Zeitung abonnieren,
die aktuelle oder alte Ausgaben bestellen
sowie eine Probeausgabe bekommen

in der Druck- oder Onlineform

Werbung
Judentum und Religion